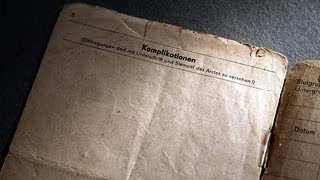Warum Steuern und Abgaben gegen die Flut des Einweg-Mülls nicht ankommen
Ende Januar schien es, als werde Tübingen bundesweit Schule machen. Nachdem damals die kommunale Verpackungssteuer der schwäbischen Universitätsstadt vom Bundesverfassungsgericht für zulässig erklärt worden war, begannen in vielen anderen Städten Überlegungen und Diskussionen, ob auch sie eine Steuer auf alle Einwegverpackungen, -becher und -bestecke für Nahrungsmittel und Getränke des örtlichen To-go-Verkaufs erheben sollen. In Tübingen sind es 50 Cent für Kaffeebecher oder Pommes-Schalen und 20 Cent für Einwegbestecke inklusive Eislöffel. Doch die Zahl der nachahmungswilligen Städte hält sich bisher in sehr engen Grenzen.
Dabei ist der Müllberg gigantisch. Allein die Zahl der hierzulande verbrauchten Einweg-Kaffeebecher beläuft sich laut Umweltbundesamt auf mehr als 2,5 Milliarden Stück pro Jahr. Und obwohl jeder einzelne Becher oder Pizzakarton, jede einzelne Sushi-Schale oder Salat-Box fast nichts wiegt, wird das Gesamtgewicht dieser Einweg-Take-away-Behältnisse in Deutschland auf gut 350.000 Tonnen pro Jahr geschätzt. Mit entsprechend großer Belastung der lokalen Müll-Entsorger und Stadtreinigungen.
Doch mit einer kommunalen Steuer will vorerst kaum eine Stadt dagegen angehen. Schon erhoben wird sie außerhalb von Tübingen nur in Konstanz. Einigermaßen sicher geplant ist sie lediglich in Heidelberg, Köln und Bremen. Während in Freiburg der Gemeinderat gegen die ablehnende Haltung von Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) das Projekt weiter vorantreiben will, gibt es in Darmstadt, wo sich die Einführung zunächst angebahnt hatte, „noch keinerlei verbindliche politische Beschlüsse, weder des Magistrats, noch der Stadtverordnetenversammlung“, wie die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mitteilte. Und in der ganz großen Mehrheit der anderen Städte wird eine solche Steuer entweder bis auf Weiteres klar abgelehnt – etwa Berlin und Frankfurt/Main – oder in einer Weise geprüft, die keinen besonderen Ehrgeiz erkennen lässt.
„Dass viele Städte bei der Einführung einer kommunalen Verpackungssteuer nach dem Tübinger Modell zögern, liegt vor allem daran, dass sie sich trotz des Karlsruher Urteils noch nicht in jeder Hinsicht auf der rechtlich sicheren Seite sehen“, sagt Henning Wilts, der sich als Abteilungsleiter am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie sehr intensiv mit Strategien gegen jene Abfallberge befasst. Rechtliche Unklarheiten sehen unter anderem bayerische Großstädte, die sich vorerst dadurch gebunden fühlen, dass es nach dem Kommunalabgabengesetz des Freistaats erst einmal der Zustimmung des bayerischen Innenministeriums bedarf, wenn eine Steuer neu eingeführt wird. Das Ministerium aber ist derzeit ebenfalls noch in der Prüfungsphase.
Hinzu kommt nach Einschätzung von Wilts, dass sich viele Städte fragen, ob der Verwaltungsaufwand bei der Verpackungssteuer „in einem angemessenen Verhältnis zum gewünschten Ergebnis der Abfallreduzierung steht“. Schon in Tübingen ist der Reduktionseffekt seit der Einführung der dortigen Steuer im Januar 2022 nicht klar. So hat der Wirtschaftswissenschaftler Stephan Moderau untersucht, ob sich das Gewicht des Abfalls in öffentlichen Mülleimern Tübingens nach der Einführung jener Steuer verringert habe. Das war demnach nicht der Fall. „Auch im Vergleich mit Kontrollstädten ergibt sich keine Reduktion“, sagte Moderau dem baden-württembergischen „Staatsanzeiger“.
Erfolg aber habe Tübingen mit der parallel zur Steuer-Einführung praktizierten Förderung von Mehrweg-Angeboten beim Außer-Haus-Verkauf. „Da steht Tübingen jetzt pro Einwohner bundesweit auf Platz eins“, sagte Moderau. Hierbei allerdings ist zu berücksichtigen, dass die vielen Studenten in der Stadt ohnehin sehr offen für das Thema Abfallvermeidung sind und Mehrweg-Angebote grundsätzlich bereitwillig nutzen.
Dass somit in Tübingen die Verhältnisse recht speziell sind, wirft bei der Frage nach einer Übernahme des Modells durch andere Städte ein weiteres Problem auf, sagt Wilts, der die Müllmengen sehr unterschiedlicher Kommunen untersucht hat. Es gebe „beim Abfallaufkommen durch Einweg-to-go-Verpackungen sehr große Unterschiede zwischen großstädtischen Innenstadtbezirken, ländlichen Räumen und Universitätsstädten“.
Und „wenn die verschiedenen Kommunen daran die Höhe ihrer jeweiligen Verpackungssteuern ausrichten, kann es zu einer erheblichen Vielfalt der Steuersätze kommen“. Eine solche fiskalische Vielfalt aber könne „die großen Anbieterketten von To-go-Produkten vor erhebliche Schwierigkeiten stellen“. Denn für jeden Ort müsste dann einzeln berechnet werden, wie die jeweiligen Verpackungssteuer-Sätze die Gesamtkalkulation etwa von Kaffee- oder Fast-Food-Ketten beeinflussen.
Noch etwas macht die flächendeckende Übernahme des Tübinger Modells schwierig: Es weist große Schnittmengen mit einem anderen flächendeckenden Projekt bei diesem Thema auf. Mit dem Einwegkunststofffonds, den die derzeit noch geschäftsführende Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) in der Zeit der Ampel-Koalition auf den Weg gebracht hatte.
Hierbei müssen die Hersteller bestimmter Kunststoff-Einwegmaterialien – von To-go-Produkten über Chipstüten bis hin zu Luftballons – eine Sonderabgabe zahlen, die in einen Fonds fließt, den das Bundesumweltamt verwaltet. Dieses wiederum soll das Geld an die Kommunen weiterleiten, um sie bei den Kosten der Müll-Entsorgung zu entlasten. Diesem System flächendeckend noch kommunale Verpackungssteuern hinzuzufügen, wäre der herstellenden Industrie sowie großen Anbieterketten oder Lieferdiensten nur schwer zu vermitteln.
Indes kommt jener Einwegkunststofffonds derzeit nur schwer in Gang: Laut einem „FAZ“-Bericht vom Januar haben sich erst 3800 abgabepflichtige Unternehmen in das Register des Umweltbundesamts eintragen lassen. Rund 56.000 aber wären zur Eintragung und zu Einzahlungen verpflichtet.
Sollte man also, wenn Regulierungsmaßnahmen des Bundes und der Kommunen so zäh vorankommen, die Müllberge hinnehmen und stattdessen auf Recycling der Verpackungen setzen?
„Nur so kann Mehrweg zur Regel werden“
Das wäre „keine Alternative“, sagt Wilts. „Erstens kann der Inhalt eines Mülleimers im öffentlichen Raum aus Gründen des Finanz- und Personalaufwands nicht sortiert werden, sondern geht komplett in die Müllverbrennung. Zweitens wäre die Verbrennung der meisten Verpackungen selbst bei einer Sortierung unvermeidbar, weil viele dieser Verpackungen gar nicht recyclefähig sind. Denn sie bestehen sehr oft aus unterschiedlichen Materialien – etwa Papier mit Kunststoffüberzug –, die sich kaum noch trennen lassen.“ Zudem mache die Verschmutzung von vielen dieser Verpackungen mit Essensresten das Recycling „extrem aufwendig“.
Deshalb sei Mehrweg in diesem Produktsegment der eindeutig bessere Weg. Aber da sei „die Bilanz der letzten Jahre ernüchternd“, sagt Wilts: „Einwegverpackungen legen deutlich zu, während der ohnehin geringe Mehrweganteil wieder zurückgeht.“ Nicht bewährt habe sich insofern die bisherige Vorgabe, dass die Verkaufsstellen lediglich Mehrweg-Angebote bereithalten müssen, woran sich aber auch längst nicht alle Unternehmen halten würden. „Sinnvoller wären strafbewehrte Vorgaben zu Mehrwegquoten, die alle Anbieter erreichen müssen“, sagt Wilts. „Nur so kann Mehrweg zur Regel werden, und nur dann lässt sich in diesem Bereich zu einer Standardisierung gelangen, die wirtschaftliches und auch ökologisches Agieren möglich macht.“
Was aber die Wirtschaftlichkeit von Mehrweg-Systemen betrifft, so gibt es bei ihnen bisher nach Wilts‘ Beobachtung „lauter kleine Insellösungen einzelner Anbieter, die mit vielen verschiedenen Geschirrformen arbeiten“. Diese ließen sich oft schlecht stapeln und somit nicht platzsparend unterbringen. Zudem würden sie wegen der vielen verschiedenen Formate nicht in jede Reinigungsanlage von gewerblichen Spülstraßen passen und müssten daher für jede Säuberung aufwendig hin und her gefahren werden. „Wirtschaftlich wird dieser Sektor erst dann“, sagt Wilts, „wenn klare Vorgaben und Preisaufschläge für Einweg-Verpackungen die Mehrweg-Behältnisse zum Standard machen, der in großen Mengen produziert und überall leicht gereinigt werden kann.“
Ob diese Mehrweg-Behältnisse dann aus Kunststoff oder anderen Materialien bestehen, ist für Wilts aber zweitrangig. „Kunstoff-Mehrweg ist jedenfalls deutlich besser als Einweg-Verpackungen, die zur Vermeidung von Plastik aus Aluminium oder ökologisch problematischen Holzarten bestehen.“
Politikredakteur Matthias Kamann schreibt für WELT über Umweltthemen.
Dieser Artikel ist im Rahmen der BETTER FUTURE WEEK von WELT erschienen.
Unser Angebot für Sie zur BETTER FUTURE WEEK
Lesen Sie mehr Beiträge zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Testen Sie WELT AM SONNTAG und WELTplus Premium – 5 Wochen lang für nur 5 Euro!
Nutzen Sie Ihre Gewinnchance: Unter allen Bestellern verlosen wir ein E-Bike von Hoheacht sowie 10 Damen- und 10 Herrenräder von Triumph.
JETZT BESTELLEN!
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke