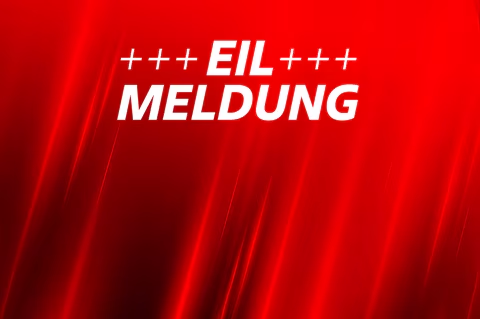China setzt seine Seltenen Erden als Waffe ein – und Bayern triff es hart
Erst waren es nur diplomatische Drohgebärden – nun geraten amerikanische und europäische Konzerne gewaltig unter Druck. Im Machtkampf zwischen den USA und China setzt Peking genau dort an, wo es besonders weh tut: bei den Seltenen Erden. Plötzlich wird ein geopolitisches Risiko spürbar, das vielen in Europa bislang abstrakt erschien. Wie weit will Peking gehen – und wie lange kann es sich diese Strategie leisten?
Seit dem 4. April dürfen sieben Seltene Erden – darunter Samarium, Dysprosium und Yttrium – nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung exportiert werden. In vielen chinesischen Häfen stehen die Kräne still, während Peking ein neues Lizenzsystem aufsetzt. Europäische Unternehmen berichten von unterbrochenen Lieferketten.
Offiziell begründet Peking den Exportstopp mit den Zollerhöhungen von Donald Trump. Doch die Maßnahme trifft nicht nur Washington – sie richtet sich auch gegen Europa.
Die Rohstoffe sind essenziell für die europäische Industrie: Sie stecken in Elektromotoren, Windrädern, Halbleitern und medizinischer Technologie. Die deutsche Wirtschaft bezieht laut Statistischem Bundesamt rund zwei Drittel ihrer Seltenen Erden aus China, bei einzelnen Metallen wie Lanthan oder Neodym sind es weit über 90 Prozent. Eine Versorgungskrise würde direkt auf die Hightech-Industrie durchschlagen.
Wegbrechende Einnahmen treffen China dagegen kaum. Die Metalle, die vom Lieferstopp betroffen sind, machen nur einen Bruchteil der chinesischen Ausfuhren aus. Peking setzt damit ein deutliches Signal: Wer sich wirtschaftlich und sicherheitspolitisch gegen China stellt, muss mit Konsequenzen rechnen.
Schon 2010 stoppte China Exporte nach Japan – damals im Zuge eines Territorialkonflikts um die Senkaku-Inseln. Ein chinesisches Fischerboot war von japanischen Behörden festgesetzt worden war. Neu ist die Systematik: Die aktuellen Kontrollen sind Teil einer langfristigen Strategie, wirtschaftliche Abhängigkeiten als geopolitisches Instrument zu nutzen.
Chinas Dominanz ist das Resultat jahrzehntelanger Industriepolitik. Schon in den 1990er-Jahren forcierte Peking gezielt Abbau- und Verarbeitungskapazitäten – oft unter Inkaufnahme hoher Umweltbelastungen. Heute kontrolliert China über 90 Prozent der weltweiten Verarbeitungsleistung für Seltene Erden. Gerade schwere Metalle, die für Hochleistungsmagnete gebraucht werden, können fast nur dort raffiniert werden.
Konzerne weltweit merken jetzt, wie verwundbar sie sind. Unternehmen wie Mercedes, ZF oder Bosch prüfen ihre Lieferketten, Mittelständler berichten von geplatzten Aufträgen. Für Bayern ist die Lage besonders heikel – die dortige Wirtschaft stuft die Versorgung mit Neodym, Yttrium und Scandium als kritisch ein.
Laut einer Studie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) sind diese Metalle für den Hightech-Standort unverzichtbar – vor allem in Bereichen wie Elektromobilität, Leuchtmittel- und Brennstoffzellentechnologie. Doch ihre Preise steigen, Recycling steckt in den Anfängen, Ersatz ist schwierig. Erst ein Prozent der eingesetzten Seltenen Erden wird laut vbw weltweit recycelt.
EU sucht noch Partner
Einige Länder versuchen schnell zu diversifizieren. Die USA haben Ende April ein Abkommen mit der Ukraine geschlossen, das ihnen bevorzugten Zugang zu wichtigen Metallen sichert. Europa dagegen tut sich schwer mit solchen strategischen Partnerschaften.
Zwar verfügt die Ukraine über 22 der 34 von der EU als kritisch eingestuften Mineralien, doch ein vergleichbares Abkommen fehlt. Brüssel ringt um eine gemeinsame Linie, geopolitische Strategien scheitern oft an kurzfristigen nationalen Interessen.
Noch hat Peking die Kontrolle. Aber wie lange lässt sich die Welt einschüchtern? Je häufiger China wirtschaftliche Abhängigkeiten instrumentalisiert, desto größer wird das Interesse, diese zu reduzieren. Schon jetzt investieren Australien, Kanada, Japan und die USA in neue Kapazitäten. Auch in Europa wächst der Druck: Der Aufbau strategischer Reserven und mehr Recycling gelten als Priorität.
Für China stellt sich die Frage, ob kurzfristige Erfolge langfristige Nachteile überwiegen. Die Rolle des verlässlichen Lieferanten steht auf dem Spiel. In einer Welt, die auf Resilienz setzt, könnte China an Einfluss verlieren.
Der Exportstopp ist mehr als eine wirtschaftspolitische Episode. Er ist ein Test für Europas strategische Souveränität. Wie Europa reagiert, wird zeigen, ob es geopolitisch mithalten kann – oder Spielball bleibt.
Christina zur Nedden berichtet im Auftrag von WELT seit 2022 aus Asien.
Christina zur Nedden berichtet im Auftrag von WELT seit 2022 aus Asien. https://www.welt.de/autor/christina-zur-nedden/
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke