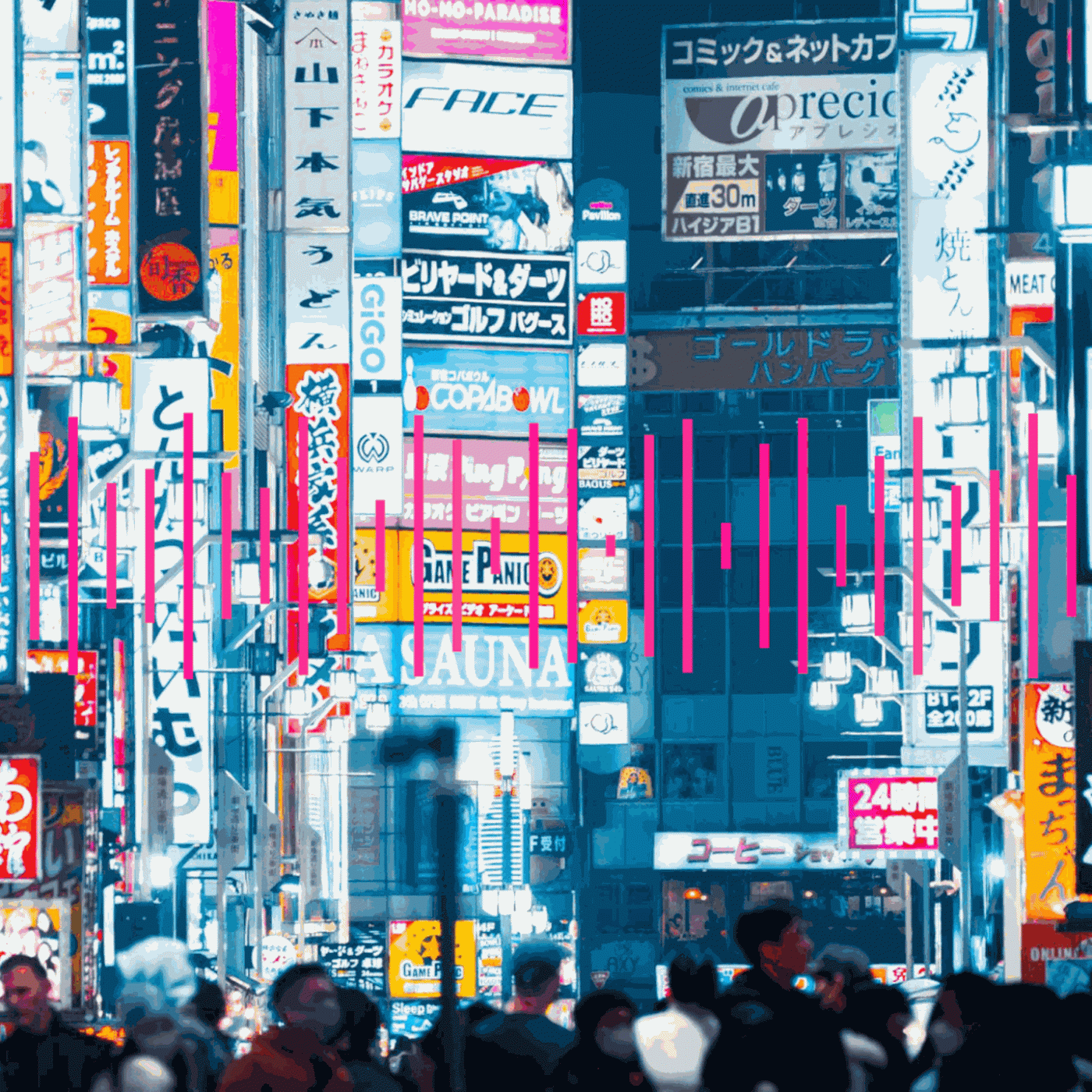Warum Alaska am besten mit dem Schiff zu entdecken ist
Klingt unglaublich, stimmt aber: Die größte Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika kennt fast kein Mensch. New York? Los Angeles? Chicago? Alles falsch. Die korrekte Antwort lautet: Sitka.
Diese entlegene Siedlung in Alaska kommt zwar nur auf die Einwohnerzahl von Kappeln an der Schlei, also etwa auf 8500, allerdings auf eine Fläche von 12.461 Quadratkilometern. Sitka ist annähernd so groß wie Schleswig-Holstein.
Am Meer liegt es auch, eingebettet in eine üppig-grüne Regenwaldlandschaft, raue Küste, Gebirge. Mount Edgecumbe, ein fast 1000 Meter hoher Vulkan, heißt der Hausberg, gut sichtbar vom Stadtkern aus. Am Himmel über Sitka kreisen und kreischen Weißkopfseeadler, Amerikas Wappentiere, im Hafen liegen Fischkutter, Motorboote und Urlauberschiffe vor Anker.
An architektonischen Augenschmeichlern hat das Provinzstädtchen, einmal abgesehen von der hölzernen orthodoxen Sankt-Michaels-Kathedrale mit ihren russischen Zwiebeltürmen, wenig zu bieten; gleich dahinter reihen sich Plattenbauten mit Ostblock-Charme aneinander. Dennoch lohnt ein Besuch. Sitka ist erstens enorm geschichtsträchtig und zweitens eine der wichtigsten Totempfahl-Stätten weltweit.
Für einen Apfel und ein Ei
Es waren Russen, die den Ort auf die Landkarte setzten. Im 18. Jahrhundert tauchten sie erstmals in Alaska auf und gründeten eine Siedlung, die sie Neu-Archangelsk tauften und die ab 1808 als Hauptstadt der Kolonie Russisch-Alaska fungierte. In den 1860er-Jahren war das Zarenreich nach dem Krimkrieg in Finanznot geraten. Es verkaufte den Amerikanern das weitgehend menschenleere, unwirtliche Riesenterritorium 1867 für 7,2 Millionen US-Dollar, quasi für einen Apfel und ein Ei – mit einem Vertrag, der in Neu-Archangelsk unterzeichnet wurde.
Kurz darauf wurde der Ort in Sitka umbenannt, der neue Name wurde abgeleitet von der alten Ortsbezeichnung der Ureinwohner: Sheet’ka. Die zeitweise russische Vergangenheit Alaskas war auch der Grund, dass die Region Mitte August Schauplatz des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin war.
Doch wichtiger und prägender als das kurze russische Intermezzo ist für Alaska das uralte kulturelle Erbe der lokalen indigenen Völker des amerikanischen Nordwestens. Sie waren vor mehr als 10.000 Jahren über die Beringstraße aus Sibirien eingewandert, passten sich an das raue Klima und die Gegebenheiten der Natur an. Totempfähle, von denen in einem Waldpark in Sitka um die 20 in den Himmel ragen, sind ein zentrales Element ihrer Identität.
Diese Monumente sind in der gesamten Region zwischen Anchorage, der größten Stadt Alaskas, und Vancouver im Nordwesten Kanadas zu finden, so auch in Hoonah, Skagway und Ketchikan. Diese Küstenorte sind Pflichtstationen auf einer weltweit einzigartigen Bildungsreise, einer Art Totem-Tour.
Die Entfernungen sind dabei beträchtlich, gut 2100 Kilometer von Nord nach Süd, was ungefähr dem Luftweg von Berlin nach Portugal entspricht – quer durch pure, dünn besiedelte Natur. Noch heute leben in ganz Alaska, das fast fünfmal so groß wie Deutschland ist, weniger Menschen als in Frankfurt/Main.
Kein durchgehendes Straßennetz
Wer auf den Pfaden der Indigenen wandeln und Totempfähle besichtigen will, kann dies nicht auf dem Landweg tun, sondern nur über Wasser. „Im Südosten von Alaska gibt es kein durchgehendes Straßennetz“, sagt Kyle McDonnell, dessen Reisefirma mehr als hundert Touristenbusse betreibt, vor allem für den Transport von Kreuzfahrtreisenden auf kürzeren Strecken. Selbst im eisfreien Sommer wären Mietwagen oder Wohnmobil nutzlos.
Nach Juneau, die abgelegene Hauptstadt Alaskas im Südostzipfel, dem sogenannten Panhandle, kommt man sogar nur per Flugzeug oder Schiff, nicht mit Auto oder Bahn. Aus diesem Grund hat sich der Törn zwischen Anchorage und Vancouver zu einem Klassiker im amerikanischen Kreuzfahrtbusiness entwickelt. „Im Jahr haben wir aktuell etwa 1,6 Millionen Passagiere“, schätzt McDonnell. Um die 30 Schiffe, eher mittelgroß als riesig, pendeln hier pro Saison die Küste rauf und runter.
In unserem Fall ist es die „Riviera“. Was insofern originell ist, als die eigentliche Riviera, also die italienische Küste, weit weg von Alaska liegt und das 239-Meter-Kreuzfahrtschiff vom Betreiber Oceania Cruises auf den Marschallinseln registriert wurde, in der Südsee.
Allerdings stampft die „Riviera“ mit maximal 1250 Passagieren – fast alle US-Bürger und Kanadier – erst seit 2025 durch den Nordpazifik; vorher kreuzte sie im Mittelmeer. Anchorage, wörtlich „Ankerplatz“, ist nun Start der Totem-Tour, wobei im Nachbarort namens Whittier an Bord gegangen wird.
Leitmotiv dieser Reise ist die Kultur der indigenen Völker in Amerikas Nordwesten – oder auch, wie man es in Kanada vorzugsweise ausdrückt, der First Nations. Bei denen bilden die Tlingit eine der größten Gruppen. Allein in Alaska, erst 1959 vom US-Territorium zum 49. Bundesstaat aufgestiegen, gibt es mehr als 200 Stämme, darunter die Nisga’a, Gitxsan, Haida, Tsimshian, Haílzaqv, Nuxalk, Kwakwaka’Wakw und Nuu’-Chah-Nulth.
Spirituell, aber nicht religiös
Bei Totempfählen ist es wichtig zu verstehen, was sie nicht sind: Sie haben nichts mit Tod oder gar Töten zu tun, wie manche irrtümlich meinen. Es handelt sich auch keineswegs um schauderhafte Marterpfähle, wie sie etwa die Erzählungen des Wildwest-Fantasten Karl May oder James Fenimore Coopers Roman „Der letzte Mohikaner“ von 1826 klischeehaft aufgegriffen haben. Totempfähle sind spirituell, aber nicht religiös, und strotzen offensichtlich vor Leben und Lebewesen.
Sie sind in der Regel auch nicht uralt. Mitunter halten sie mehr als ein Jahrhundert durch, oft nicht. Sie werden aus dem widerstandsfähigen Stammholz von Riesen-Lebensbaum und Fichte geschnitzt, ragen typischerweise acht bis höchstens 18 Meter in die Höhe und sind bis zu zehn Meter tief im Erdreich verankert. Da sie draußen stehen, sind sie Wind und Wetter und Regen und Frost ausgesetzt; früher oder später werden sie desolat und verfallen. Mitunter werden sie dann durch originalgetreue Repliken ersetzt.
Ursprünglich stand das indigene Wort „Ototeman“ für ein Verwandtschaftsverhältnis, eine Zugehörigkeit. Im Englischen, später auch im Deutschen, machten Ethnologen und Missionare, die mit den Urvölkern in Kontakt kamen, daraus „Totem“. Ein Totempfahl ist eine Erinnerungshilfe, eine Gedächtnisstütze – im Wesentlichen das, was im Deutschen das Wort „Denkmal“ meint. Zum Beispiel für ein besonderes Ereignis, ein Fest, eine wichtige Zusammenkunft oder auch einen Konflikt.
Zugleich „repräsentiert jeder Totempfahl einen der örtlichen Stämme hier“, sagt Katherine Ruby aus Idaho, die im Küstenort Ketchikan zur Saison als Busfahrerin arbeitet. „Es ist unsere Art und Weise, die Geschichte nicht zu vergessen“, erklärt Edward John Malline Zowish. Der 69-jährige Tlingit wuchs in Sitka auf und hat selbst an zwei Pfählen, die dort im Gedenkpark stehen, mitgewirkt.
Tiere der Region sind die Hauptmotive. Sie gelten als Ahnen oder Schutzgeister einer Familie, Sippe oder eines ganzen Stamms und sind mit diesen spirituell eng verbunden. So sind auf vielen Totempfählen Grizzlybär und Adler zu finden, Biber oder Wolf, Frosch oder Orca oder auch stilisierte menschenähnliche Gestalten.
„Tiere sind unsere Brüder und Schwestern“, sagt die 22-jährige Kassidy Bryant aus Lax Kw’Alaams, die dem Volk der Tsimshian angehört und als Guide arbeitet. „Das Totem ist unsere Verbindung zu den Spirits im Land. Alle Tiere haben für uns ein Bewusstsein, so wie Menschen.“
Eine besondere Rolle spielt der Rabe in der Mythologie vieler indigener Völker. So ist er bei den Tlingit und Haida eine Schöpferfigur, die einst – nicht anders als in der biblischen Genesis – Licht, Sonne, Mond, Sterne und Wasser erschuf. Bei aller Weisheit und Pragmatik gilt der Vogel zugleich als durchtriebener Geselle, der mit Witz und Schlauheit in die Welt hineinwirkt, in seinem zwiespältig-opportunistischen Charakter, mal freundlich, mal weniger, der menschlichen Natur nicht unähnlich. Wer einem Clan mit dem Raben als Totem angehört, darf sich ein bisschen besonders fühlen.
In der Totem-Hauptstadt der Welt
Das Örtchen Hoonah ist die größte Siedlung der Tlingit in Alaska, Kreuzfahrer landen allerdings ein Stück weiter in Icy Strait Point an, inzwischen dank Seilbahn, Zipline und reihenweise Souvenirshops mit der etwas gewöhnungsbedürftigen Anmut eines Actionparks. Skagway mit seinen Häusern im rauen Wildwest-Stil, die an die Zeit des Klondike-Goldrauschs erinnern, ist da gefälliger.
Das eine Tagesetappe weiter südlich gelegene Ketchikan wiederum, 1885 gegründet, wirbt damit, „die Totem-Hauptstadt der Welt“ zu sein – und deren „Dosenlachs-Hauptstadt“ obendrein. Der im Nordwesten Amerikas allgegenwärtige Fisch ist hier ein Hauptwirtschaftszweig, wird in Blech eingeschweißt und in alle Welt verschickt.
In Sachen Einwohnerzahl ist Ketchikan etwa so groß wie Sitka, also übersichtlich. Der Ort sorgt in dieser abseitigen Weltgegend aber geradezu für „Stadtgefühl“ – nicht zuletzt, weil es hier McDonald’s, Starbucks, Wal-Mart und eine richtige Shopping Mall gibt.
Im Creek District stehen hingegen urige Holzhäuser auf Stelzen im Wasser, wobei ein besonders hübsches, mintgrün gestrichenes, in alter Zeit einer gewissen Dolly Arthur gehörte, die im örtlichen Rotlichtviertel als Puffmutter wirkte und als charakterstarke Persönlichkeit galt. Heute ist das Ex-Bordell ein Museum.
Die größten Sehenswürdigkeiten des Orts, der in der Saison von mehreren Kreuzfahrtschiffen täglich angelaufen wird, sind aber der Saxman Totem Park und der Totem Bight State Park, beide etwas außerhalb gelegen.
Flüssiger Sonnenschein
Gegen Ende der Reise stampft die „Riviera“ durch die imposante Szenerie der Inside Passage zwischen Skagway und Vancouver – was bedeutet: Abschied von Alaska, Ankunft in British Columbia.
Über die dortige Industriestadt Prince Rupert ist zu sagen, dass die Sonne nirgends in Kanada weniger scheint. Außerdem ist es hier nasser als irgendwo sonst im zweitgrößten Flächenstaat der Erde, was auch irgendwie eine Leistung ist: 260 Regentage im Jahr, im Schnitt über sieben Millimeter täglich. Aber die Leute hier machen das Beste daraus. Wenn es mal wieder tagelang regnet, sprechen sie launig von „liquid sunshine“, Sonnenschein in flüssig.
Auch in Vancouver, der bei Weitem größten Hafenstadt auf dieser Kreuzfahrt und zugleich deren Endstation, gibt es reichlich Totempfähle zu besichtigen. Sie stehen im vier Quadratkilometer großen Stanley Park auf einer Landzunge unweit des Stadtzentrums, umgeben von majestätischen Douglasien.
Das berühmteste Wahrzeichen der kanadischen Millionenmetropole ist jedoch ein Pfahl der etwas anderen Art. Der huldigt nicht Spirituellem, sondern einem besonders gefräßigen Totem der Moderne: der Zeit.
Der Gastown Steam Clock ist ein dampfbetriebener Uhrenturm im gleichnamigen historischen Stadtteil. Der Zeitmesser sieht stilistisch auf den ersten Blick nach 19. Jahrhundert aus, wurde allerdings erst 1977 errichtet, ist also ein vergleichsweise junges Ding.
Der kuriose Apparat mit Dampfmaschine im Unterbau schmaucht und pfeift zur vollen Stunde, was ihn geradezu lebendig wirken lässt. Vancouvers qualmendes Wahrzeichen ragt nur knapp sechs Meter in den Himmel, kann also nicht mit den Dimensionen von Totempfählen mithalten. Aber da er nicht aus Holz ist, sondern aus Messing, Bronze, Glas und Stahl, dürfte er deutlich länger stehen bleiben als diese.
Tipps und Informationen:
Wie kommt man hin? Wer nach Anchorage (Alaska) fliegt, muss umsteigen, am besten in Seattle; Flüge zum Beispiel mit United oder Condor/Alaska Airlines. Alternativ fliegt man nonstop nach Vancouver (Kanada) mit Lufthansa, Condor oder Air Canada. Touristen benötigen für die USA eine elektronische Einreiseerlaubnis (ESTA, umgerechnet 20 Euro, ab 30. September 2025 umgerechnet 34 Euro; esta.cbp.dhs.gov). Kanada-Flugreisende brauchen die Einreisegenehmigung eTA (rund fünf Euro, canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html).
Kreuzfahrten: Schiffe von Oceania Cruises kreuzen regelmäßig entlang der Westküste Kanadas und Alaskas, neun Tag Anchorage–Vancouver kosten ab 3179 Euro pro Person im Stateroom, ab 6929 Euro in der Penthouse Suite (de.oceaniacruises.com). Mit der luxuriösen „Seven Seas Explorer“ ist Regent Seven Seas Cruises auf der Route unterwegs, acht Tage ab 5669 Euro (rssc.co); Azamara Cruises hat mehrere längere Kreuzfahrten mit kombiniertem Landprogramm im Angebot, eine 13-Tage-Reise von Anchorage nach Victoria/Kanada kostet ab 5569 Euro (azamara.com).
Weitere Infos: travelalaska.com; travel.destinationcanada.com. Museen, die sich den indigenen Kulturen widmen: Anchorage Museum und Alaska Native Heritage Center (anchorage.net/things-to-do/museums-and-culture), Museum of Northern British Columbia in Prince Rupert (museumofnorthernbc.com).
Die Recherche wurde unterstützt von Oceania Cruises. Unsere Standards der Transparenz und journalistischen Unabhängigkeit finden Sie unter go2.as/unabhaengigkeit.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke