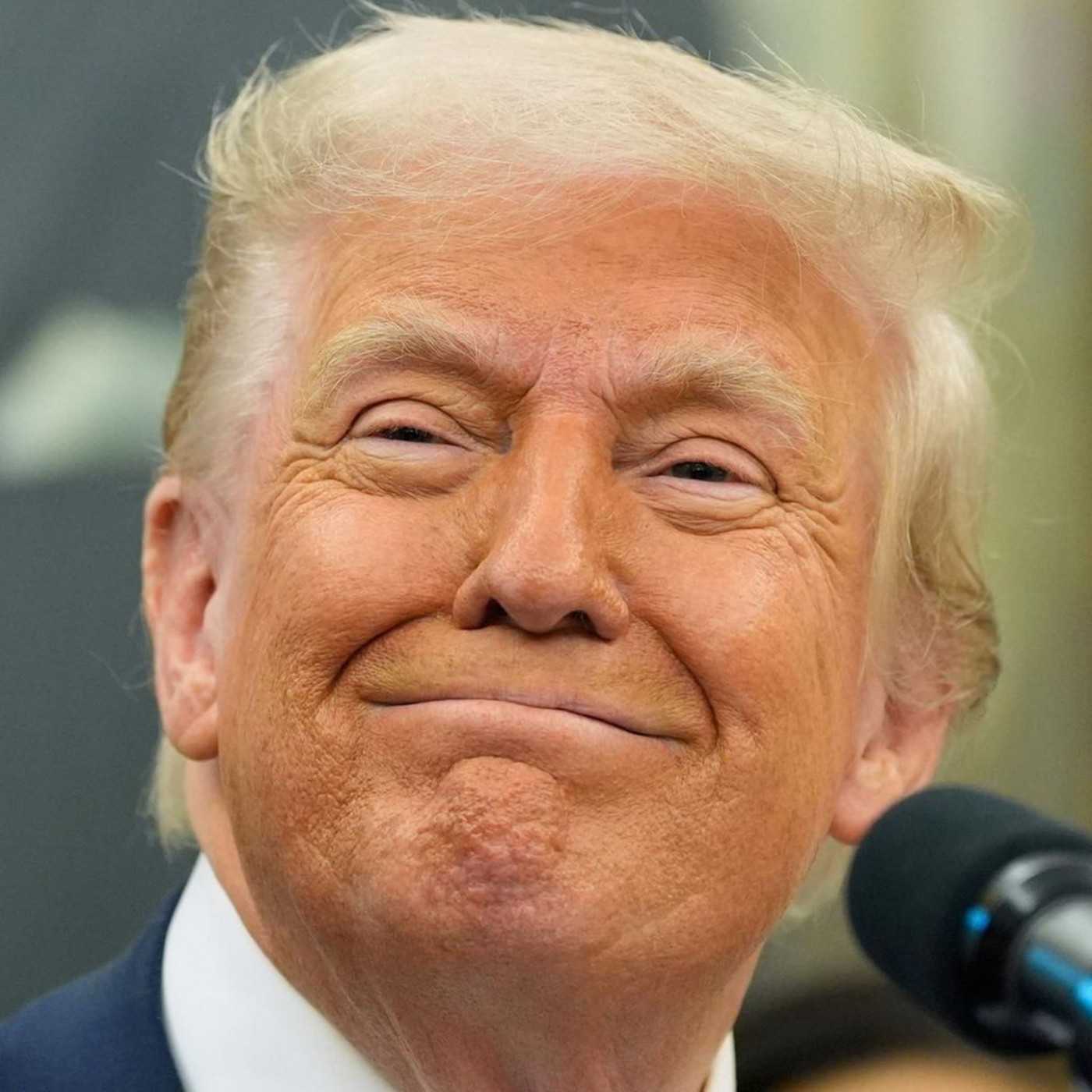Speichern von Wind- und Sonnenenergie wird immer drängendere Frage
- Quaschning: Ausbau von Stromspeichern erfolgt bisher im "Blindflug"
- Heimspeicher und Elektrofahrzeuge könnten auch für Netzstabilität genutzt werden.
- Sachsen-Anhalt will Batteriespeicher für Unternehmen voranbringen
In Staßfurt im Salzlandkreis soll ein Batteriespeicher ab 2025 rund 600 Megawattstunden Strom speichern können – rein rechnerisch können dem Betreiber "Eco Stor" zufolge damit rund eine halbe Million Haushalte für jeweils zwei Stunden morgens und abends mit Strom versorgt werden. Die Batterien speichern in Spitzenlastzeiten überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien und geben ihn wieder ab, wenn wenig oder keine Energie aus Photovoltaik und Windkraft erzeugt werden. Im sächsischen Boxberg ist sogar ein Batteriespeicher mit mehr als 1.000 Megawattstunden (MWh) Kapazität geplant. In Wittenberg baut die Firma Tesvolt unterdessen ihren Standort zur Produktion von Batteriespeichern aus: Vier Gigawattstunden pro Jahr sollen hier künftig auf den Markt kommen. Ob Produktion oder Installation der Speicher: In Mitteldeutschland wetteifern Unternehmen um die Superlative.
Batteriebranche hinkt trotz rasantem Wachstum hinterher
Das Geschäft mit Stromspeichern brummt. Fast 16 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete die Energiespeicherbranche vergangenes Jahr deutschlandweit. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) beziffert das Gesamtwachstum auf 46 Prozent im Vergleich zu 2022. Trotzdem betont Simon Steffgen, Referent für Industrie und Gewerbe beim BVES: "Für das Gelingen der Energiewende reicht das Wachstum aktuell noch nicht aus." Bislang habe man sich bei Erneuerbaren Energien stark auf Erzeugung, Transport und Verbrauch fokussiert. Das ändere sich nun.
Denn der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie schreitet rasant voran. "Wir müssen uns sehr schnell überlegen: Was machen wir damit?", sagt auch Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft. Die Speicherfrage sei daher essenziell. Dass schon heute in besonders sonnen- oder windreichen Phasen große Mengen Erneuerbarer Energien abgeregelt werden, sieht er dabei nicht einmal als das größte Problem.
Quaschning: Ausbau von Stromspeichern im "Blindflug"
Stattdessen verweist er auf fossile Kraftwerke, die mit einer Mindesterzeugung (Must-Run-Kapazitäten) weiterlaufen, um beispielsweise kurzfristige Schwankungen und Stromausfälle ausgleichen zu können. "Diese Aufgaben können auch Batterien übernehmen. Momentan haben wir die aber nicht", sagt Quaschning. Es sei "absurd", wenn Solar und Windräder abgeschaltet werden, damit die sogenannten Must-Run-Kapazitäten für Kohlekraftwerke weiterlaufen können.
Wir müssen uns sehr schnell überlegen: Was machen wir mit überschüssiger Wind- und Sonnenenergie?
Beim Ausbau der Stromspeicher befinde sich Deutschland allerdings im "Blindflug", meint Quaschning. Zwar sei erfreulich, in welchem Tempo der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft zuletzt vorankam. "Aber nun muss man den zweiten Schritt gehen und die Speicherfrage sehr schnell angehen", sagt er. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz veröffentlichte zuletzt im Dezember eine Stromspeicher-Strategie. Nun führe man dazu "Detailgespräche mit der Branche", erklärt eine Ministeriumssprecherin. Um die komplexeren Maßnahmen wie etwa eine möglichst verlässliche Zubau-Prognostik zu entwickeln, wolle man auch gutachterliche Expertise einbinden. Denn das dezentrale Stromnetz der Zukunft bringt ganz neue Herausforderungen mit sich.
Potenziale von Heimspeichern und Elektrofahrzeugen noch ungenutzt
Nach Daten der Bundesnetzagentur kommen Batteriespeicher in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen derzeit insgesamt auf eine Kapazität von 258 MWh und eine Leistung von 222 MW. Damit sind sie noch weit entfernt von den Kapazitäten schon länger bestehender Pumpspeicher. Besonders die Thüringer Pumpspeicher stechen mit einer Kapazität von 35.176 MWh und einer Leistung von 1.624 MW heraus – die Ausbaupotenziale dieser älteren Technologie sind allerdings unter anderem durch geografische Anforderungen begrenzt.
Deutschlandweit dürften allein Großbatteriespeicher bis zum Jahr 2037 auf eine Leistung von rund 24 Gigawatt (GW) kommen, Batteriespeicher für Photovoltaik-Anlagen (PV) auf weitere rund 67 GW. Das sehen Szenarien aus dem Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur vor. Gesetzliche Vorgaben, wie viele Batteriespeicher bis wann entstehen sollen, gibt es nicht. Allerdings seien feste Ausbauziele auch eher sekundär, meint Simon Steffgen vom BVES, "weil in den reinen Ausbauzahlen nicht beschrieben ist: Wo müssen die Anlagen stehen und welche Dienstleistungen müssen sie vollbringen?"
In den reinen Ausbauzahlen ist nicht beschrieben: Wo müssen die Speicheranlagen stehen und welche Dienstleistungen müssen sie vollbringen?
Viel wichtiger sei daher, "die Schaltstellen im Energierecht und in der Energie-Regulatorik an den relevanten Punkten zu justieren." So könnten etwa auch Heimspeicher und Elektrofahrzeuge so in das Energiesystem integriert werden, dass sie zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. "Diese Potenziale müssen genutzt werden", fordert Steffgen. Auch Quaschning erklärt, es müssten "ganz klare Anforderungen an alle Speicher" definiert und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit ausreichend Speicher gebaut werden.
Sachsen-Anhalt plant Förderprogramm für Industrie und Gewerbe
In Sachsen-Anhalt verweist Umweltminister Armin Willingmann auf ein geplantes Förderprogramm für Batteriespeicher, das noch dieses Jahr an den Start gehen soll. Insgesamt 22 Millionen Euro aus EU-Mitteln sollen vor allem Industrie und Gewerbe zugute kommen.
"Damit wollen wir es auch für Unternehmen attraktiv machen, sich entsprechende Speicherkapazität zuzulegen", sagt Willingmann. Bisher geht das Wachstum bei Batteriespeichern vor allem auf Heimspeicher zurück. Von derzeit 578 geplanten Speichern in Sachsen-Anhalt sind dem Ministerium zufolge 21 große Speicher mit einer Kapazität ab einer MWh bis hin zum Großprojekt in Staßfurt mit 600 MWh.
Es gebe einen Trend, Speicher dort zu bauen, wo viel erneuerbare Energien vorhanden sind, sagt Steffgen vom BVES. Gerade in den Strukturwandelregionen in Sachsen und Sachsen-Anhalt sei dabei eine "spannende Dynamik" zu beobachten. Die Potenziale der Transformation – weg von der traditionellen Kohleverstromung hin zu Erneuerbaren Energien – würden zunehmend erkannt. "Die Wertschöpfung der Energie bleibt dann nämlich auch in der Region", stellt er mit Blick auf aktuell geplante Großspeicher und Speicherfabriken fest.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke