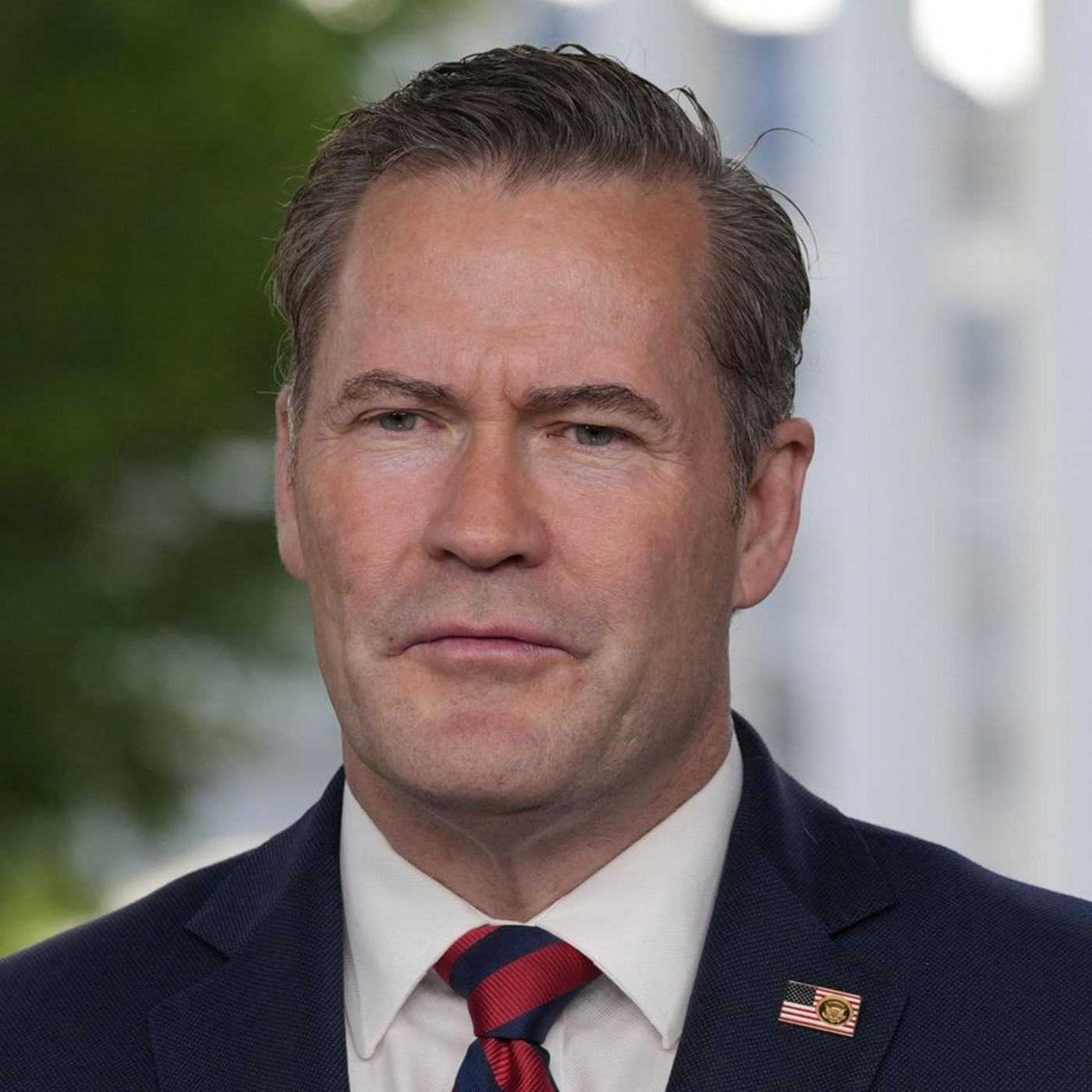Als eine Grußbotschaft der Ex-Terroristin verlesen wird, klatscht die Menge
Am späten Nachmittag füllt sich der Platz an der U-Bahnstation Südstern in Berlin-Kreuzberg. Polizisten stehen auf Dächern, scannen die Menge. Die Lage ist angespannt. Banner werden hochgezogen, Gesichter vermummt. Umstehende Journalisten werden als „Kapitalistenschweine“ beschimpft. Eine Gruppe junger Männer zündet erste Pyrotechnik. An der Spitze des Zuges: ein körperlich behinderter Mann, eine bekannte Figur der propalästinensischen Szene Berlins. Immer wieder hallt es: „Free, free Palestine!“
Auch die FDP-Politikerin Karoline Preisler ist vor Ort – wie fast immer bei propalästinensischen Demonstrationen. Sie setzt sich gegen den Israel-Hass und für die Freilassung der von Hamas-Terroristen verschleppten Israelis ein – sechs Polizisten schützen sie, während sie in Diskussionen verwickelt wird.
In der Menge: Plakate mit antisemitischen Parolen, Banner des anti-israelischen Sanktionsbündnisses BDS, der palästinensischen Organisation Samidoun, von kommunistischen Jugendbünden. Im Lautsprecherblock wird skandiert: „Freiheit für alle politischen Gefangenen.“ Ob die von der Hamas festgehaltenen Geiseln damit gemeint sind, bleibt offen. In einer Seitenstraße stehen pro-israelische Demonstranten – auch sie unter Polizeischutz.
Noch vor dem ersten Schritt der sogenannten revolutionären Mai-Demonstration wurde ein Grußwort der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette verlesen. Von „Völkermord an Palästinensern“, deutscher Komplizenschaft, Kapitalismus und Revolution ist darin die Rede. Es wirkt wie ein Echo aus einer vergangenen Zeit. Der Applaus ist lang
Gleichzeitig läuft eine zweite, visuelle Ebene mit. Während der gesamten Demonstration entstehen Selfies, es wird vor Bannern posiert, Material für Social Media gesammelt. Da ist die Frau mit Kopftuch, die vor einem Polizeiauto die Revolutionärin mimt. Da sind die jungen Männer, die vor dem schwarzen Block schnell grimmig in die Kamera schauen. Der 1. Mai wird für viele zur Fotokulisse.
An der Spitze des Aufzugs: die Vereinigung „Migrantifa“. Hinter ihr marschiert eine Gruppe der Linkspartei mit palästinensischen Fahnen und Plakaten, auf denen steht: „Stop the Genocide“. Der Bundestagsabgeordnete Ferat Kocak (Linke) führt sie an. Er trägt eine Warnweste, die ihn als „parlamentarischen Beobachter“ kennzeichnet.
Wie schon 2024 dominieren vor allem propalästinensische Parolen das Bild. Auf Plakaten steht: „Keine Waffen für Israel“, immer wieder werden Sprechchöre angestimmt – „From the river to the sea“. Die Polizei schreitet in mehreren Fällen wegen antisemitischer Äußerungen ein. Die Emotionalisierung durch den Nahost-Konflikt ist spürbar – nicht zuletzt auf der Sonnenallee, wo Protest und Alltag seltsam ineinandergreifen. Männer am Rand rufen Parolen wie „Free, free Palestine“, die Menge skandiert sie nach.
Es sind nicht die einzigen Slogans, in denen eine Täter-Opfer-Umkehr vollzogen wird. Auf einem großen Banner steht etwa: „Antifaschismus heißt: Kampf der Nato. Stoppt den Krieg gegen Russland“ – ganz so, als hätte nicht Russland die Ukraine überfallen, sondern umgekehrt.
Von einem Balkon hält ein kleiner Junge ein Blatt mit den Worten „Free Palestine“ hoch. Die Menge bejubelt ihn. Ein Mann mit pinkfarbenem Banner („Dolls & Fags gegen Genocide“) feuert die Menge an: „There is only one solution.“ Die Demonstrierenden rufen: „Intifada! Revolution!“ Und erneut: „From the river to the sea – Palestine will be free.“
In den Seitenstraßen von Neukölln sichern immer wieder Polizisten die Zugänge. Als der Zug vorbeizieht, ruft es: „Ganz Berlin hasst die Polizei.“ Es bleibt zunächst ruhig – bis in der Nähe der Neukölln Arcaden eine volle Wasserflasche fliegt und eine Polizistin am Kopf trifft. Die Stimmung droht zu kippen.
Ein Redner des kommunistischen Jugendbundes brüllt ins Mikrofon: „Als Diener dieses Staates seid ihr unsere Feinde. Ihr seid das, was zwischen uns steht und der sozialistischen Revolution.“ Die Menge jubelt. Wenige Straßen weiter, auf den Balkonen im bürgerlichen Teil Neuköllns, wird der Kampftag zur Gartenparty. Während klassenkämpferische Rhetorik durch die Straßen hallt, gibt es Würstchen, Bier, Selfies. Mitnicken im Takt.
Inzwischen kehrt die Spitze des Zuges zum Südstern zurück. Polizei-Hundertschaften stehen bereit. Es sind ein paar Minuten, in denen die Stimmung kippen könnte. Plötzlich steht überall Polizei. Die Beamten setzen ihre Helme auf. Es gibt erste Rangeleien.
In einem Hauseingang wird ein Festgenommener von Polizisten abgeschirmt, umringt von einer wütenden Menge. „Shame on you“, schreit es von allen Seiten. Was genau passiert ist, bleibt unklar. Lautsprecherdurchsagen zur Auflösung der Versammlung bleiben aus. Immer wieder ähnliche Szenen: Ein junger Mann schreit einen Beamten an, scheinbar grundlos – der Beamte entscheidet sich gegen eine Festnahme und zieht weiter.
Und dann ist da Shane O’Brien. Das Pali-Tuch tief ins Gesicht gezogen, tanzt er vor einem Musikbus. Der Mann, der an der Besetzung eines Hörsaals der FU Berlin beteiligt war, könnte bald sein Bleiberecht verlieren. Heute aber tanzt er als wäre alles gut.
Zwischen 15.000 und 18.000 Teilnehmer zählte die Polizei am Abend, die Veranstalter sprechen von bis zu 30.000. Sichtbar ist vor allem eines: Der linksautonome Block, der in früheren Jahren das Bild prägte, ist kaum noch auszumachen. Auch größere Ausschreitungen bleiben aus. Die Polizei spricht von einzelnen Vorfällen.
Damit wiederholt sich ein Bild aus dem vergangenen Jahr. Es sind Szenen, die eher an ein Straßenfest erinnern als an die traditionell konfrontative 1.-Mai-Demonstration in Kreuzberg. Wer heute durch den Kiez zieht, trifft kaum noch auf die Geister der Vergangenheit.
Vor fast vier Jahrzehnten, im Mai 1987, wurde Kreuzberg erstmals zur Kampfzone. Steine flogen, Molotowcocktails brannten, Polizisten mussten sich unter der U-Bahntrasse ducken. Die Bilanz: Dutzende Verletzte, Plünderungen, brennende Autos – und das Bild eines ausgebrannten Supermarkts, das bundesweit zum Symbol wurde.
In den Folgejahren institutionalisierten sich die Krawalle. Die sogenannte „Revolutionäre 1.-Mai-Demo“ wurde zum festen Bestandteil der linken Szene. 1989 eskalierte die Lage erneut: über 340 verletzte Beamte, ein Millionenschaden. Der Senat hatte auf Deeskalation gesetzt – und war gescheitert. In den 90er-Jahren dann der Gegenschlag: martialisches Polizeiaufgebot, Prügeleien, Festnahmen, zerstörte Kneipen. Gewalt auf beiden Seiten. Noch 2010 wurden fast 480 Menschen in der Nacht zum 2. Mai von der Polizei nach den Krawallen in Gewahrsam genommen. Die Statistik spricht für sich.
Mit der Jahrtausendwende begann sich das Bild zu verändern. Der damalige Kreuzberger Halis Sönmez hatte die Idee zum „Myfest“ – einem Straßenfest mit Musik, Kultur und Nachbarschaft. Aus dem Aufruhr wurde ein Ritual, aus dem Ritual ein Fest. Die Revolution wich dem Caipirinha, die brennenden Barrikaden der Bühne. Mit dem Fest und einer ausgeklügelten Polizeitaktik konnte der 1. Mai befriedet werden.
Doch auch ohne Fest blieb es in diesem Jahr weitestgehend ruhig. Am Abend flogen vereinzelt Flaschen, Pyrotechnik wurde gezündet. Es kam zu einzelnen Festnahmen. Bereits kurz nach 22 Uhr ist es ruhig am Südstern. Keine Musik, kein Geschrei – nur Scherben, Flaschen, Einsatzwagen. Was mit dem verklärten Grußwort begann, endet in Stille.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke