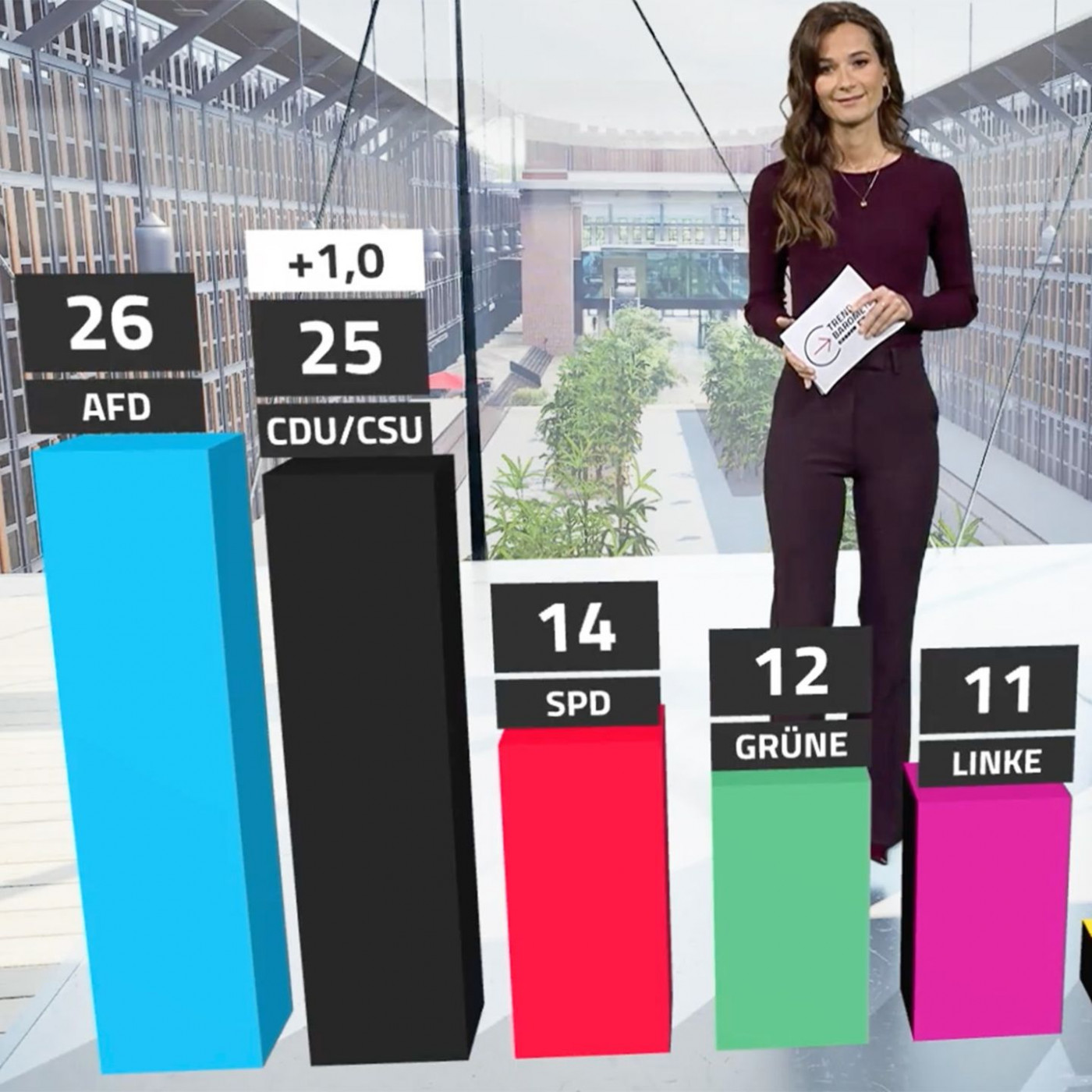Wie man die Rente sicherer machen kann
Die alljährlich steigenden Bundeszuschüsse ins Rentensystem machen das Problem eigentlich für jeden sichtbar. Da klafft ein gewaltiges Loch zwischen Einnahmen und Ausgaben. Zugeschüttet wird es mit sperrigen Begriffen. "Allgemeiner Zuschuss", "zusätzlicher Zuschuss" (!), die Zuschüsse für Kindererziehungszeiten, knappschaftliche Rentenversicherung und "andere Bundesmittel" summieren sich mittlerweile auf weit über 100 Milliarden jährlich, Tendenz steigend.
Ein Drittel des Bundeshaushalts wird es 2026 werden, das hat das IFO-Institut ausgerechnet: 127,8 Milliarden Euro innerhalb des kommenden Jahres. Das Umlage-System trägt sich schon lange nicht mehr selbst. Das rechnet auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung selbiger vor, bisher ohne nachhaltigen Erfolg.
Experte sieht fixiertes Rentenniveau kritisch
Martin Werding ist Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum und Mitglied des Sachverständigenrates für Wirtschaft. Er hält zum Beispiel schon von der "Haltelinie 48 Prozent" nichts, die das Rentenniveau bis 2031 und auch danach festschreiben soll. "Das Rentenniveau bei 48 Prozent zu fixieren ist heikel."
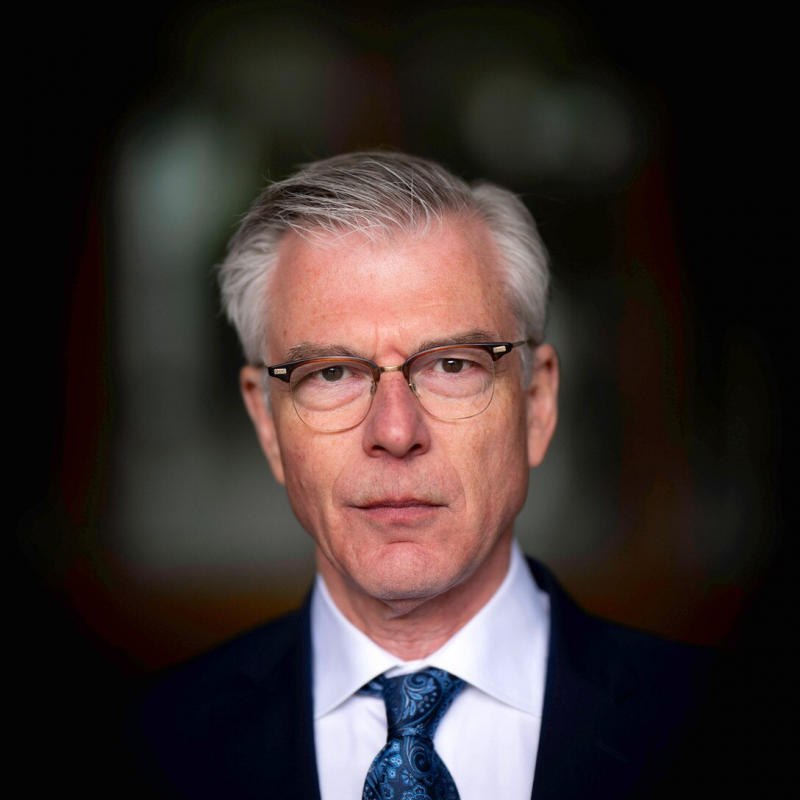 Prof. Martin WerdingBildrechte: IMAGO / IPON
Prof. Martin WerdingBildrechte: IMAGO / IPONDer Hintergrund: Die "Babyboomer", also die in den 1960er-Jahren Geborenen, gehen jetzt massenhaft in Rente, die Lebenserwartung steigt weiter, die Zahl der Beitragszahler sinkt und das auf lange Sicht. Die Kinder, die einzahlen müssten, sind aber noch nicht geboren, nicht einmal ihre Mütter und Väter. Das ist auch so schnell nicht änderbar, sagt Werding und betont, Demografie sei träge. Das nächste gesellschaftliche Streitthema sei die Zuwanderung.
1965 haben noch fünf Beitragszahler einen Rentner getragen, jetzt haben wir fast ein Verhältnis von 2:1 erreicht, Tendenz: Es wird noch schlechter. Man muss nicht höhere Mathematik studiert haben, um auf einem Bierdeckel ausrechnen zu können, dass ohne Bundeszuschüsse quasi jeder der aktuell gut zwei Beitragszahler fast ein halbes Nettogehalt hinblättern müsste, damit der eine Rentner auf seine 48 Prozent von seinem ehemaligen Netto kommt.
Wirtschaftswissenschaftler kritisiert Umlagesystem
Prof. Bernd Raffelhüschen, Wirtschaftswissenschaftler und Renten-Experte, hat im ZDF-Mittagsmagazin vorgerechnet, was mathematisch unser Problem ist: Das Umlagesystem ist für eine Jopi-Heesters-Rentenbezugszeit einfach nicht geschaffen. "Wissenschaftlich können wir nachweisen, dass ein Mensch heute 20 Jahre Rente bekommt und dafür 40 Jahre gearbeitet hat. Früher hat man 10 Jahre Rente bezogen und 45 Jahre gearbeitet."
Beamte und Politiker einzahlen lassen? Fair und gerecht und rechnerisch nutzlos
Die Forderung, Beamte und Politiker ins gesetzliche System zu holen, taucht in Wahlkämpfen besonders gern auf. Klingt gerecht, kann man deshalb auch machen, bringt mathematisch aber leider trotzdem nichts. Denn auch diese Gruppen haben zu wenige Kinder bekommen und werden am Ende aus dem System ihre Rente bekommen wollen. Und der Beamte sogar tendenziell länger als der Arbeiter.
Der Sozialpolitiker Werding sagt dazu: "Beamte leben im Durchschnitt etwas länger […] das würde das System sogar belasten. Das ist ein reiner Verschiebebahnhof." Die weiteren mathematischen Stellschrauben, die uns im bestehenden System zur Verfügung stehen würden, sind leider auch keine, mit denen man Wahlen gewinnt. Die da wären: Rentenkürzung bis zu einer "Grundrente", und/oder höhere Beiträge und/oder Frühverrentung stoppen und/oder Lebensarbeitszeit verlängern.
Ist nur noch die Grundrente sicher?
Rechnerisch reicht der Topf der gesetzlichen Rente eigentlich nur noch für das Notwendigste: Wohnen, Essen, Heizen. Für Kreuzfahrt, Auto und das komfortable Leben im Alter bräuchte es zusätzliche Quellen, momentan sichert das der Bundeshaushalt.
Werding empfiehlt deshalb der jungen Generation dringend, mindestens für diesen "Luxus" selbst vorzusorgen und zwar nicht als Roulette-Spiel, sondern breit gestreut, konsequent, langfristig. Stichwort ETF-Fonds, die die langfristigen Börsenbewegungen abbilden. Rendite könne nämlich in einem reinen Umlagesystem nicht entstehen, sondern nur am Kapitalmarkt. Die Stimmungsmache mit "Casino-Rente" und "Zockerei", sei - freundlich formuliert – uninformiert..
Der Mut zur Wahrheit fehlt – noch
Das eigentlich Fatale ist nicht der demografische Wandel selbst, sondern, dass wir als Gesellschaft seit Jahren so tun, als ließe sich das Problem mit ein paar Milliarden und Haltelinien lösen. Vielmehr bräuchte es einen realistischen Pfad für das Rentenzugangsalter, der sich an der Lebenserwartung orientiert.
 Prof. Dr. Bernd RaffelhüschenBildrechte: IMAGO / Reiner Zensen
Prof. Dr. Bernd RaffelhüschenBildrechte: IMAGO / Reiner ZensenDer Renten-Experte Raffelhüschen schlägt deshalb vor, wie in Skandinavien das Rentenzugangsalter schrittweise auf 70 zu erhöhen und den Nachhaltigkeitsfaktor wieder wirksam werden lassen. Dessen Wirkung in der Rentenformel: Sinkt die Zahl der Beitragszahler im Verhältnis zu den Rentenbeziehern (zum Beispiel aufgrund der Demografie), wird die Rentenanpassung gedämpft, um die Belastung der Beitragszahler zu verringern.
Außerdem dürften wir den vorgezogenen Ruhestand nicht mehr bezuschussen, fordert Raffelhüschen. "Mit diesen drei Sachen hätten wir die Sache im Griff, aber wir müssen es jetzt machen, nach 2032 ist es zu spät".
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke