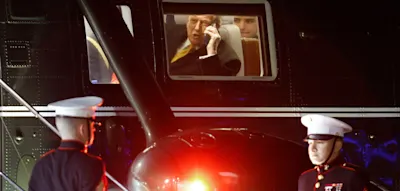Als überschreite man eine Grenze zwischen zwei Wirklichkeiten
Es ist früher Nachmittag. Von der Jaffa Road in Jerusalem führen jene Straßen ab, die zum ultraorthodoxen Viertel Mea Shearim führen. Die Sonne scheint so hell, dass die weißen Steine, aus denen die meisten Häuser hier gebaut sind, glühen. Gerade noch gab es eine Falafel bei Aisha, eine Empfehlung aus dem Internet. Und während in Deutschland Regen fällt, brennt die Sonne hier mit dreißig Grad und mehr. Das langärmelige Hemd klebt am Rücken.
Dieses Hemd ist aber wichtig, weil es heißt, Gäste müssten sich hier „bedeckt“ halten. Und weil man erzählt, dass Touristen, oder zumindest Leute, die so aussehen, in Mea Shearim nicht willkommen sind. Rauer Ton, klare Ansage. Ist das wirklich so? Oder ist das Bild von Mea Shearim unfreundlicher als die Realität? Dann kommen die Poller, die das Viertel abgrenzen. Es ist ein unscheinbarer Schritt. Einer, den man auf einer Karte kaum einzeichnen könnte. Und doch fühlt es sich sofort an, als überschreite man eine Grenze zwischen zwei Wirklichkeiten.
Ein ultraorthodoxer Jude, traditionell gekleidet, kommt sofort hinter den Pollern hervor. Erfolgt jetzt eine Ermahnung? Wird das Kommen als Eindringen empfunden? Doch er lächelt, streckt die Hand aus und stellt sich als Yusuf vor. Er spricht kaum Englisch, ein anderer Mann übersetzt. Wie sieht er die Welt draußen? Er sagt, ohne Zögern: „Sehr schlecht.“ Und dann die Erklärung: „Wir wollen nicht, dass die Welt draußen unser Leben stört. Wir wollen, dass unsere Kinder hier sicher sind.“ Er lächelt. Aber bei aller Freundlichkeit klingt das, was er sagt, bedenklich. Ob er wolle, dass Israel insgesamt religiöser werde. „Aber natürlich!“
Nicht-ultraorthodoxe Israelis blicken häufig mit Ablehnung, teilweise mit Verachtung auf die Menschen, die in Mea Shearim leben. Denn für die Ultraorthodoxen gelten häufig andere Regeln. Ein Vorwurf, der von säkularen Israelis immer wieder erhoben wird: Die Ultraorthodoxen tragen nicht zum Wohlstand des Landes bei. Im Gegenteil, sie profitierten von den Innovationen, für die Israel in aller Welt steht, die die Ultraorthodoxen aber gleichzeitig ablehnen. Sie halten sich nicht an die Gesetze, absolvieren keinen Militärdienst.
Besonders brisant ist dabei das Thema Demografie. Wegen der hohen Geburtenrate der Ultraorthodoxen steigt deren Anteil an der Gesamtbevölkerung immer weiter. Noch in diesem Jahrhundert werden Prognosen zufolge 33 bis 40 Prozent der israelischen Bevölkerung ultraorthodox sein. Mit gravierenden Auswirkungen auf die Politik. Viele liberale, moderne Israelis fürchten eine Politik, die immer religiöser, immer konservativer wird.
Was zuerst auffällt im Zentrum von Mea Shearim ist die Stille. Keine lauten Stimmen. Keine Musik. Fast keine Autos. Die wenigen rollen langsam, als müssten sie sich entschuldigen. Die Häuser sind niedrig, zwei Stockwerke, Balkone aus dunklem Gusseisen, Wäsche, die wie hingeworfen an den Leinen vor den Fenstern hängt. Die Straßen sind zum Teil so schmal, dass sie eher wie Gänge wirken.
Und sie wirken ärmlich. Nicht verwahrlost. Aber so, als sei hier das Leben von etwas anderem abhängig als von Konsum. Männer in langen, schwarzen Mänteln mit Schläfenlocken, die sich wie Spiralen entlang der Wangen ziehen, gehen über die Straßen. Frauen hingegen sind kaum zu sehen. Und wenn, dann nur in Bewegung — schnell, ohne Blickkontakt. Ihre Haare sitzen makellos – es sind Perücken. Ultraorthodoxe Frauen dürfen nach der Hochzeit ihre echten Haare nicht mehr zeigen.
Viele Gassen sind leer. „Die Kinder sind in der Schule“, sagt jemand im Vorbeigehen. Die Männer würden lernen. Die Frauen seien zu Hause. Sie arbeiten und erziehen, versorgen — und halten zusammen. Ultraorthodoxe Frauen organisieren Familien mit durchschnittlich sieben Kindern, organisieren den Haushalt. Die Männer studieren. Stundenlang, tagein, tagaus.
In einer Seitenstraße steht ein junger Mann aus Manchester. Schlomo, 21 Jahre alt. Er spricht akzentfreies Englisch, ist höflich, fast sanft. Er ist erst seit kurzem hier. „Wir lernen den ganzen Tag“, sagt er, „morgens bis abends. Es gibt keine Unterhaltung oder Ablenkung.“ Er lacht kurz. „Zwischendurch gibt es Pausen, dann kann ich mit Freunden einfach reden.“ Ist er glücklich? „Ich gewöhne mich dran“, sagt er. Das klingt ehrlich. Es klingt nach jemandem, der versucht, einen neuen Rhythmus zu finden, in dem nichts ihn ablenkt.
Traueranzeigen werden plakatiert
Was auffällt: In den Straßen hängen große Plakate. Es ist aber keine Werbung. Es sind Todesanzeigen. Gesichter, Namen, Lebensläufe. Das Sichtbarmachen von Abschied mitten im Alltag. Ganze Straßenzüge sind plakatiert mit Todesanzeigen. Auch das fühlt sich sehr fern an — und gleichzeitig ungewohnt nah.
Dann kommt ein Laden für „koschere Handys“. Die Auslage ist irritierend. Es handelt sich um uralte Modelle, die man in westlichen Ländern seit vielen Jahren nicht mehr nutzt. Keine Smartphones. Sondern alte Handys mit Tasten und kleinem, gerahmtem Display. Ein junger Mann erklärt: „Ein koscheres Handy heißt, dass man damit nur telefonieren kann.“ Daher brauche es keine anderen Funktionen. „Kein Whatsapp, und überhaupt: kein Internet.“
Ein anderer fügt hinzu: „Dafür gibt es zwei Gründe. Einmal die Gesundheit. Wir wollen unseren Kopf nicht schädigen. Der zweite: Wir wollen uns auf das Wahre konzentrieren. Den Grund, warum wir hier sind.“ In seinen Augen ist keine Askese zu sehen – sondern Konzentration. Eine Entscheidung.
Die Thora-Schule ist der Mittelpunkt
Plötzlich ist es so, als öffne sich das Herz des Viertels. Die Straße vor der Thora-Schule ist voller Männer, Jungen, Kinder. Einige laufen in die Schule, andere kommen wieder heraus. „Hier sind also alle“, kommt es einem in den Sinn – nach dem Gang durch die halb leeren Straßen und Gassen. 170 Klassen gibt es an dieser Thora-Schule, erklärt ein Mann. 9000 Schüler sollen es insgesamt sein. Eli, der durch die Räume führt, sagt: „Wir lernen immer in Paaren. Der eine fragt, der andere antwortet. Es ist ein Dialog.“
Kein Schweigen. Kein kontemplatives Sitzen. Lernen ist hier Lautstärke. Bewegung. Ein Körper der Worte, Gesichter voller Intensität. Nicht Fanatismus. Eher Konzentration auf etwas, das größer ist als sie selbst. Die Männer sollen ein Leben lang hier ihre Religion lernen. Mit 20 Jahren geht es los.
„Die ältesten sind Mitte 90“, erklärt Eli. Unverheiratete kommen um 7:15 Uhr morgens in die Thora-Schule, verheiratete Männer erst um 9 Uhr. Dann wird gebetet oder man lernt eben in Zweiergruppen. Unterrichtsstunden mit Lehrern gibt es erst ab 12 Uhr. Die meisten bleiben bis spät in die Nacht.
Auf die Frage nach Spannungen innerhalb der israelischen Gesellschaft reagiert Eli gelassen: „Ich sehe keine Spannungen. Ich lasse sie leben, wie sie leben – solange sie mich leben lassen.“ Oft, sagt er, glaubten säkulare Israelis, die Religiösen wollten ihnen Vorschriften machen. „Das ist ein Fehler. Ich sage ihnen nicht, was sie tun sollen. Lass mich einfach leben.“ Ob das Westjordanland Teil Israels sein solle? „Was immer wir von unserem Land bekommen können, ist unser Land. Daran habe ich keinen Zweifel.“
Eine Gruppe kleiner Kinder läuft vorbei. „Jeder möchte doch, dass seine Kinder so werden wie er selbst“, sagt Eli und schaut den Kindern nach. „Das ist keine Frage der Religion. Wenn man an etwas glaubt und dafür lebt, möchte man, dass die Kinder dieselben Werte teilen.“ Aber welche Wahl haben diese Kinder? Wie sehr werden sie über ihr eigenes Leben entscheiden können?
Es ist spät geworden. Ich spüre kein Urteil. Sondern Faszination dafür, wie die Menschen in Mea Shearim leben. Ich habe gesehen, wie stark die Gemeinschaft in dem Viertel ist, aber auch wie beengt die Welt dort erscheint, und wie unfrei. Der Glaube hält in Mea Schearim alles zusammen — und trennt zugleich von einer Welt, die längst weitergezogen ist.
Constantin Schreiber ist Teil des Axel Springer Global Reporters Netzwerk, zu dem neben WELT auch „Bild“, „Business Insider“, „Onet“ und „Politico“ gehören.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke