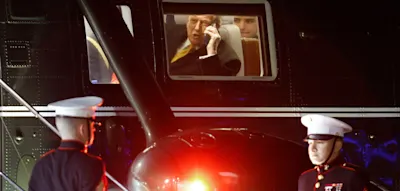Warum Polens Premier Tusk trotz guter Bilanz angeschlagen wirkt
Premier Donald Tusk wird nicht müde, Polens wirtschaftliche Erfolge zu erwähnen. Schon mehrere Male wies der Premierminister im laufenden Jahr darauf hin, dass sein Land offiziell in die Gruppe der 20 größten Volkswirtschaften der Welt gestoßen ist. „Und das ist noch nicht unser letztes Wort“, erklärte er erst im September.
Tatsächlich ist mit weiteren Jubelmeldungen zu rechnen. Polen kann seit der Transformation vom Staatssozialismus hin zur Marktwirtschaft in den 90er-Jahren auf die längste Wachstumsperiode in der jüngeren europäischen Geschichte verweisen. Seit Jahren verkünden polnische Offizielle stolz, dass sie hinsichtlich bestimmter Indikatoren wie Bruttosozialprodukt oder Wachstum allgemein andere große europäische Volkswirtschaften hinter sich gelassen haben.
Nun hat es die Schweiz getroffen. Aktuellen Zahlen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge wird Polens Bruttosozialprodukt in diesem Jahr 1,04 Billionen US-Dollar betragen – und damit die Schweiz von Platz 20 der weltgrößten Volkswirtschaften verdrängen. Und auch wenn andernorts in Europa Krise herrscht, für Polen wird auch im Jahr 2025 ein beachtliches Wachstum von 3,4 Prozent vorausgesagt. Das sind Werte, von denen Deutschland derzeit nur träumen kann.
Die genannten Zahlen sind auch im öffentlichen Raum sichtbar. Sie zeigen sich nicht nur in der Warschauer Skyline; mit dem Warsaw Tower auf der Nordseite des Zentralbahnhofs in der Hauptstadt ragt dort mittlerweile der höchste Wolkenkratzer der EU in die Höhe. Er ist ein Symbol für den Aufstiegswillen eines ganzen Landes. Die Menschen verdienen und leben gut. Überall wird gebaut, Autobahnen und Schnellzugtrassen entstehen in enormem Tempo. Atomkraftwerke und ein neuer Flughafen bei Warschau sind weitere Großprojekte.
Der Dienstleistungs- und Technologiesektor boomt, Polen ist längst nicht mehr nur die verlängerte Werkbank für deutsche oder französische Unternehmen. Touristen aus dem Ausland staunen über saubere Innenstädte und strömen in neue Hotelanlagen an der Ostsee und in den polnischen Bergen; das Land lobt sich selbst für niedrige Verbrechensraten und eine digitalisierte Gesellschaft.
Eine strikte Migrationspolitik wird von der Mehrheit der Polen befürwortet. Und viele sind stolz auf ihre Streitkräfte. Mit beinahe fünf Prozent seiner Wirtschaftsleistung gibt kein Nato-Land mehr für Verteidigung aus als der Frontstaat Polen. Doch trotz aller Erfolge sind viele Polen unzufrieden.
Die Drei-Parteien-Koalition unter Donald Tusk ist unbeliebt. Seine liberal-konservative Bürgerkoalition (KO) steht einer aktuellen Umfrage zufolge bei gerade mal 29 Prozent der Wählerstimmen. Damit liegt sie zwar knapp vorn, die stärkste Einzelpartei indes ist mit 27,6 Prozent weiterhin die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).
Bei Tusks KO, die seit Dezember 2023 regiert, handelt es sich um ein Parteienbündnis, das überdies in der Koalition auch noch auf zwei weitere Parteienbündnisse angewiesen ist. Bleiben die Umfragen schlecht für Tusk, könnte die PiS bei den kommenden Wahlen zusammen mit der rechtsextremen Konfederacja mehr als die Hälfte der Parlamentssitze gewinnen. In Europa droht Polen damit wieder auf Konfrontation zu seinen Partnern zu gehen.
Der Premierminister weiß darum, und er wirkt angeschlagen. Aus seinem Umfeld wird kolportiert, er wolle 2027 nicht noch einmal antreten. Im politischen Warschau möchten manche Beobachter gar vorgezogene Neuwahlen nicht ausschließen. Wie ist es möglich, dass die Regierenden nicht von den wirtschaftlichen Erfolgen des Landes profitieren?
Angriffsfläche für Populisten
Als „nicht ausschließlich polnisches Phänomen“ bezeichnet Tomislav Delinic diese Gleichzeitigkeit im Gespräch mit WELT AM SONNTAG, seit März dieses Jahres Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Warschau. „Regierungen der Mitte haben in vielen europäischen Ländern das Problem, dass sie ihre Erfolge nicht ‚verkaufen‘ können. Dazu werden sie von Populisten angegriffen“, so Delinic weiter.
Das Besondere an Polen sei dem Experten nach, dass die Regierung von Tusk nach acht Jahren PiS-Regierung mit übersteigerten Erwartungen der Wähler konfrontiert sei. Während des Wahlkampfs 2023 hatte Tusk versprochen, das strenge Abtreibungsrecht zu liberalisieren und die sogenannte Justizreform zurückzudrehen.
Nichts davon ist geschehen; Mehrheiten konnte die Regierung nicht organisieren, die Gerichte im Land sind zu großen Teilen immer noch mit PiS-Loyalisten besetzt. Darüber hinaus ist die KO als Gegenentwurf zur PiS angetreten, ohne allerdings eine eigene, positive Agenda zu haben. Viele Wähler wissen bis heute nicht, wofür Tusk steht – abgesehen von einer Gegnerschaft zur PiS. Tusk hat die kaum wechselwilligen Wähler der PiS gegen sich, und er verliert in den eigenen Milieus, weil er in ihren Augen Wahlversprechen nicht einlöst.
Viele Wähler sehen die wirtschaftliche Lage des Landes darüber hinaus nicht im Vergleich mit anderen Ländern in Europa. Die Wirtschaft schließlich wuchs auch schon vor 2023 erheblich, also in der Regierungszeit der PiS. Und auch damals schon gab Polen Rekordsummen für Rüstung aus. Polen begreift Russland als unmittelbare Gefahr. Sicherheit und Verteidigung haben für viele Menschen im Land höchste Priorität.
Welche Rolle Tusk außenpolitisch spielt, wollen viele nicht wahrhaben. Dabei hat er das Land wieder in der EU verankert. Mit Brüssel ist er trotz der ungelösten Justizkrise nicht auf Konfrontation, so wie die PiS.
Der ehemalige EU-Ratspräsident inszeniert sich als gut vernetzter Europapolitiker; Milliardengelder, die wegen des Justizstreits lange von der Kommission zurückgehalten worden waren, wurden nach dem Regierungswechsel freigegeben. „Außenpolitisch funktioniert Polen sehr gut, innenpolitisch aber vermissen viele bei Tusk Antworten auf drängende Fragen“, erklärt Delinic.
Seit dem Sieg von PiS-Kandidat Karol Nawrocki bei den Präsidentschaftswahlen im Juni dieses Jahres haben die Fliehkräfte in der Koalition auch noch zugenommen. Offensichtlich wird, dass die KO und ihre Partner über keinen Plan B verfügen und sie es seit Nawrockis Amtseinführung im August mit einem Präsidenten zu tun haben, der es darauf anlegt, die Reformpolitik der Regierung bei jeder Gelegenheit, etwa mit seinem Veto, zu blockieren.
Die Aussicht darauf, über eine Präsidentenamtszeit von fünf Jahren kaum ein innenpolitisches Reformprojekt umsetzen zu können, lähmt die Koalition und frustriert ihre Wähler. „Es war möglicherweise ein Fehler, dass die Regierung dem ehemaligen Präsidenten Andrzej Duda nicht mehr Reformvorhaben vorgelegt hat. Nun scheint es, sie habe viele Reformen gar nicht erst versucht“, erklärt Delinic.
Tusk muss zügig einen Weg finden, mit Präsident Nawrocki Kompromisse zu schließen oder an ihm vorbei zu regieren. Andernfalls dürften seine Umfragewerte weiter schlecht bleiben und seine Koalition droht abgewählt zu werden.
Philipp Fritz berichtet im Auftrag von WELT seit 2018 als freier Korrespondent in Warschau über Ost- und Mitteleuropa.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke