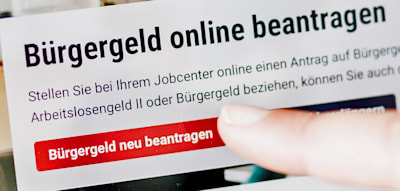Özdemirs kalkulierte Absetzbewegung von den Bundes-Grünen
Cem Özdemir steht im Institut Français in Stuttgart und trägt einen Orden mit einem kurzen grünen Band um seinen Hals. Es ist der französische Verdienstorden für Landwirtschaft, scherzhaft „poireau“ genannt: „Lauch.“ Özdemir ist nun ein „commandeur“, eine Führungskraft ehrenhalber.
Dass er die Auszeichnung kaum fünf Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 erhält, ist kein Zufall. Der seit 1883 verliehene Orden hebt hervor, dass es hier nicht nur um einen schwäbischen Landespolitiker geht, sondern um jemanden mit europäischem Format. Es ist eine diskrete Veranstaltung mit etwa 30 Gästen am vergangenen Donnerstag, gleichwohl mit internationalem Anspruch.
Hier im Raum mit den Fahnen Deutschlands, Europas und Frankreichs offenbart sich wieder einmal Özdemirs politisches Verständnis. Es ist für seine eigene Partei oft eine Herausforderung, macht ihn aber im konservativ-liberal geprägten Ländle anschlussfähig. Seine Partei tickt hier seit jeher etwas anders. „Die Grünen in Baden-Württemberg sind so etwas wie die CSU der Grünen. Wir sind anders als die Grünen in Berlin“, pflegt der Spitzenkandidat bei der Landtagswahl zu sagen, und das demonstriert der 59-Jährige im Institut Français nur allzu gern.
Zunächst ist der französische Ex-Agrarminister Marc Fesneau als Laudator an der Reihe. Mit Fesnaeu hat Özdemir, als er noch Landwirtschaftsminister der Ampel-Regierung war, eng zusammengearbeitet. Sie verstehen sich auch menschlich ausgezeichnet. „Cher Cem“, „lieber Cem“, hebt Fesnaeu zu einer warmherzigen Festrede an. Der Franzose macht Pausen, damit der Übersetzer mitkommt.
Der Sohn türkischer Eltern verkörpere seit seiner Geburt im schwäbischen Bad Urach eine „doppelte Zugehörigkeit“. Er habe seine Wurzeln in der deutschen Gesellschaft und habe schwierige Erfahrungen der Integration gemacht, wie so viele Familien, die aus dem Ausland gekommen seien. Er stehe für ein „vielfältiges, europäisches und ökologisches Deutschland“ und habe einen besonderen Dienst an der deutsch-französischen Freundschaft geleistet. Özdemir sei „Ökologe und Vegetarier“, eine Kombination, die für einen Agrarminister in Frankreich undenkbar sei. „So weit sind wir noch nicht“, sagt Fesneau.
Der Ausgezeichnete betont, er habe als Minister „immer versucht darauf zu achten, dass meine persönlichen Ernährungsgewohnheiten sich nicht mit den Zielen meines Hauses vermischen“. Darum habe er bei jeder Gelegenheit „gesagt, dass zu einer Kreislaufwirtschaft Tierhaltung logischerweise gehört“. Es entbehre, so Özdemir, auch nicht „einer gewissen Ironie, dass jemand aus einer muslimischstämmigen Familie und Vegetarier wahrscheinlich am meisten Geld für die Schweinehaltung in Deutschland mobilisiert hat. Wenn das kein Brückenbauen ist, was ist es dann?“
Özdemir demonstriert wieder einmal, dass er von Essensvorgaben, verordnetem Fleischverzicht und mahnender Zeigefinger-Politik nichts hält. Er will im längst begonnenen Wahlkampf die Klischees über moralinsaure, verbotsliebende Grünen konterkarieren. Es sind wohl vor allem die negativen Zuschreibungen für seine Partei im Allgemeinen, die den Landesverband im Südwesten befrachten und eine spürbare Überdrüssigkeit in der Bevölkerung verstärken.
Özdemir begibt sich bewusst in einen kontrollierten Widerspruch zur Bundespartei. Das ist bei den Grünen im Ländle, die seit Jahrzehnten den Realo-Flügel maßgeblich beeinflussen, traditionell so angelegt. Der beliebte, unangefochten regierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dies im Regierungsalltag seit 2011 gern zelebriert.
Dieses Mal ist eine kritische Distanz zur Bundespartei auch aus einem anderen Grund notwendig: Seit zwei Jahren liegen die Grünen in Umfragen bis zu zehn Prozentpunkte hinter dem führenden Koalitionspartner CDU; zuletzt hat sich erstmals die AfD auf Platz zwei geschoben. Özdemir, der Kretschmanns Nachfolge antreten will, ist bundesweit bekannt und im Ländle beliebt, doch es gibt einen gewachsenen Argwohn und Überdruss gegenüber seiner Partei.
Seit Monaten und bei unzähligen Terminen ist Özdemir bemüht, seine ultrapragmatische und bürgerliche Sicht auf die Dinge zu verbreiten. Wenn es im Institut Français nicht vorrangig um Landwirtschaft ginge, könnte Özdemir noch anfügen, dass die Grünen im Südwesten dem Automobil wohlwollend gegenüberstehen. Kretschmann versteht sich ohnehin als Lobbyist der heimischen Automobilbranche. Er und Özdemir sind offen dafür, die bisher ab 2035 geplante Aus für Verbrennungsmotoren bei neuen Autos zeitlich zu verschieben.
In der Bundesführung der Partei gibt es allenthalben Verständnis dafür, dass sich Özdemir migrationspolitisch härter und wirtschaftsliberaler positioniert. Grünen-Chef Felix Banaszak sagt, eine Partei, die in der aktuellen Lage bestehen wolle, müsse Orientierung geben. „Dazu gehört Profilschärfe genauso wie Diskursfreude. Das heißt, Debatten nicht nur zuzulassen, sondern sie aktiv zu suchen.“ Er habe deshalb „keinen Stress damit, dass es auch in der grünen Partei zu manchen Themen zwei oder mehr Perspektiven gibt“, sagt Banaszak WELT. „Wer in Baden-Württemberg, Berlin oder Sachsen-Anhalt antritt, braucht Beinfreiheit – und trägt dann entsprechend auch Verantwortung. Ich rate uns zu ein bisschen Gelassenheit bei Zuspitzungen und Vorstößen.“ Das bedeutet auch, Kollisionen auszuhalten, wenn etwa Fraktionschefin Katharina Dröge das Verbrenner-Ausstiegsdatum 2035 vehement verteidigt.
Bekanntheitsvorteil gegenüber dem CDU-Konkurrenten
Aktuell diskutiert Deutschland über die von Kanzler Friedrich Merz (CDU) ausgelöste „Stadtbild“-Debatte, welchen Anteil Migranten daran hätten und was vor allem „die Töchter“ bundesweit dazu sagen. Auch hier erntet Merz Kritik gerade aus dem grün-linken Milieu Kritik, dass seine Aussagen zu allgemein seien. Dabei hat Özdemir die Problematik bereits ein Jahr zuvor in einem viel beachteten Gastbeitrag für die „FAZ“ die Erfahrungen seiner Tochter angesprochen.
Erst erwähnte er rassistische Beleidigungen von Deutschen an der Ostsee. Dann drehte er die Perspektive und erzählte, es komme häufiger vor, dass seine Tochter oder ihre Freundinnen in Berlin „von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft oder sexualisiert werden“. Seine Tochter sei auch enttäuscht, dass nicht offener thematisiert werde, was dahinterstecke: „Die patriarchalen Strukturen und die Rolle der Frau in vielen islamisch geprägten Ländern.“
Auch nach Merz’ Äußerungen meldete sich Özdemir zu Wort. Er mahnte zwar kritisch eine sensiblere Wortwahl an, um Pauschalisierungen zu vermeiden, erklärte es aber für richtig, das Problem anzusprechen. „Viele Menschen scheuen öffentliche Verkehrsmittel nachts, insbesondere Frauen haben spätabends Angst, in Bahnhöfe zu gehen. Das sind einfach unerträgliche Zustände, damit haben wir uns zu beschäftigen“, sagte Özdemir im „Bericht aus Berlin“ der ARD. „Wenn wir es nicht machen, dann ist es quasi ein Wahlaufruf, AfD zu wählen.“
Özdemir setzt darauf, dass er wesentlich bekannter ist als sein CDU-Konkurrent Manuel Hagel. Özdemir läge vor diesem, wenn die Menschen den Ministerpräsidenten direkt wählen dürften, besagt eine Umfrage der „Schwäbischen“.
Doch die Landespartei hinkt seinen Beliebtheitswerten hinterher und kommt gerade noch auf 17 bis 20 Prozent. Die Ergebnisse der Landtagswahlen 2016 und 2021, wo die Grünen mit 30,3 und 32,6 Prozent ihre historisch landesweit höchsten Werte erreichten, scheinen kaum mehr erreichbar. Özdemir wirbt deshalb mit folgender Kausalkette: „Wer mich als Ministerpräsidenten haben will, muss die Grünen wählen.“
Es fehlt ein Mobilisierungsmoment wie 2011, als der Protest gegen das Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21“ viele Enttäuschte zu den Grünen führte. Danach begann der Aufstieg der Grünen im Ländle von der urbanen Nischenpartei zur Volkspartei. Sie koalierten erst mit der SPD und dann ab 2016 mit der CDU.
Dieses Mal haben sich bei den Menschen die Prioritäten verändert, wie eine am Montag vorgestellte Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung in Stuttgart offenbart. Demnach haben die Themenkomplexe Flüchtlinge/Einwanderung, Wirtschaft und Soziales deutlich an Bedeutung gewonnen, während Umweltschutz/Klimawandel deutlich an Interesse verloren hat. Eine große Mehrheit von 83 Prozent ist der Ansicht, dass Zuwanderung die Kommunen bei der Schul- und Kinderbetreuung sowie der Bereitstellung von Wohnraum überfordert. Ein weiterer Befund: Deutlich mehr Menschen favorisieren eine von der CDU geführte als eine von den Grünen geführte Landesregierung.
Özdemir fällt es als früherem Grünen-Vorsitzenden und Bundesminister leicht, bundesweite Aufmerksamkeit zu erzeugen. Am Sonntag ist er in der ARD-Talkshow „Caren Miosga“ zu Gast. Er sagt mit Blick auf die Flüchtlinge und Migranten, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland kamen, es seien „zu viele, die ungeregelt gekommen sind“. Er sieht die Zukunft im elektrischen Auto, sagt aber, dass man das Verbrenner-Aus 2025 nicht mehr erreichen könne. Er halte nichts davon, dass die Grünen in Berlin-Kreuzberg eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen den Bundeskanzler wegen der „Stadtbild“-Aussage gestellt haben.
Als Miosga ihn darauf anspricht, dass selbst der frühere grüne Außenminister Joschka Fischer meine, ein Grünen-Wahlsieg 2026 würde an ein „Wunder“ grenzen, entgegnet Özdemir: „Wir haben dreimal das Wunder geschafft. Jedes Mal hieß es, das ist ausgeschlossen, dass Winfried Kretschmann Ministerpräsident wird oder es bleibt. Und jedes Mal haben wir es geschafft.“
In der CDU ist die Bereitschaft zu einer Koalition mit den Grünen schwach ausgeprägt. Sie hätte lieber eine Deutschland-Koalition mit SPD und FDP. Doch es gibt viele Unwägbarkeiten: Die FDP steht nur knapp oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde. Falls die CDU schwächer abschneidet, könnte am Ende Grün-Schwarz als einzige Option übrig bleiben. Dann hätte Özdemir ein Minimalziel erreicht: die Beteiligung an einer Landesregierung als Juniorpartner.
Auf die Frage, ob er Minister unter einen CDU-Ministerpräsidenten Hagel sein könnte, antwortet Özdemir: „Können kann ich viel.“ Und dann sein pflichtgemäßer Zusatz als optimistischer Spitzenkandidat: „Aber ich glaube, besser wäre es, wenn die Grünen die führende Kraft für Bahnen-Württemberg wären. Das hat dem Land gutgetan, und so soll es bleiben.“
Kristian Frigelj berichtet für WELT über bundes- und landespolitische Themen, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke