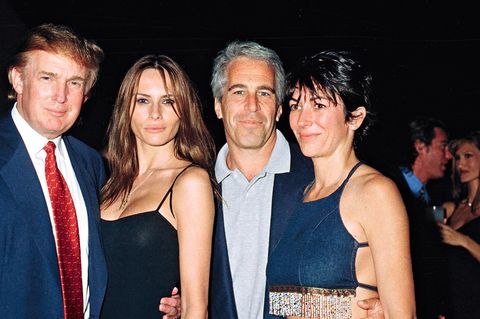Was den Planeten jetzt noch retten könnte
Vanuatu ist ein Inselparadies: Türkise Wellen streicheln weiße Sandstrände, Palmen wiegen sich träge in der Sonne. Kein Wunder, dass hier, mitten im Pazifik zwischen Fidschi, Salomonen und Neuseeland, die glücklichsten Menschen der Welt leben sollen. Oder besser: gelebt HABEN sollen. Denn laut einer britischen Studie ist das fast zwanzig Jahre her.
Dass sich das Glück mittlerweile woanders angesiedelt hat, dürfte viel mit einem Phänomen zu tun haben, das zwar die ganze Welt beschäftigt, aber bisher nur wenige so hart trifft wie eben jene Inselstaaten im Pazifik: dem Klimawandel.

Tuvalu Ein Inselparadies rettet sich in die Cloud
Mehrere Dörfer der Inselgruppe Vanuatu mussten bereits evakuiert werden, weil der steigende Meeresspiegel ihre Trinkwasserquellen versalzt. Häufiger auftretende Tropenstürme zerstören ganze Landstriche. Vor allem junge Menschen zieht es deshalb in die Hauptstadt Port Vila. Vor den Folgen der Erderwärmung, das ist klar, werden sie aber auch dort nicht dauerhaft sicher sein. Weiter nordöstlich auf Tuvalu hat sich die Hälfte der Bevölkerung schon auf Visa für Australien beworben, weil ihre Heimat in absehbarer Zeit nicht mehr existieren wird.
Wenn der Klimawandel ein Fall fürs Gericht wird
Weil sich die Lage in der Region seit Jahren zuspitzt, hat eine Gruppe Studenten 2019 eine Kampagne zum Schutz ihrer Heimat gestartet. Vanuatus Regierung brachte daraufhin eine Resolution bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen ein – die das Anliegen wiederum ans höchste Gericht, den Internationalen Gerichtshof in Den Haag (IGH), weitergab. Dort sollen die Richter über das Schicksal des Planeten entscheiden.
"Wir stehen an vorderster Front einer Krise, die wir nicht verursacht haben, einer Krise, die unsere Existenz und die Existenz vieler anderer Menschen bedroht", stellte Vanuatus Außenminister und Klimabeauftragter, Ralph Regenvanu, bei der Anhörung im Dezember 2024 vor dem IGH klar. Knapp 100 Länder und ein Dutzend Organisatoren nahmen damals daran teil. Über ein halbes Jahr später präsentieren die Richter nun ihr Rechtsgutachten, das schon vor Veröffentlichung als wegweisend gilt. Denn es könnte Klimaschäden als Verstoß gegen das Völkerrecht werten und damit die rechtlichen Verpflichtungen beim Klimaschutz neu definieren. Der Europa- und Völkerrechtler Thomas Burri von der Universität in St. Gallen spricht vom "größten Gerichtsverfahren in der Geschichte des Völkerrechts".

Meinung Diese Hitze macht mich richtig wütend – Sie hoffentlich auch!
Das Gutachten gilt zwar nicht als rechtlich bindend, aber es könnte erstmals klarstellen, welche völkerrechtlichen Verpflichtungen Staaten beim Klimaschutz haben. Eine solche richterliche Entscheidung hat es noch nie gegeben und dürfte als Grundlage für Entscheidungen bei künftigen Klimaklagen dienen. "Auch die Staaten werden sich voraussichtlich nach dem Gutachten richten; einer autoritativen Feststellung des IGH in einem Gutachten können sich Staaten auf Dauer kaum entziehen, ohne einen gewissen Preis zu zahlen", ist sich Burri sicher.
Vergleichbare Anordnungen erteilten Gerichte zuletzt in Hamburg und auf Costa Rica: Der Internationale Seegerichtshof befand, dass Staaten ihre Emissionen drastisch senken müssen, um die Ozeane zu schützen. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte forderte Länder dazu auf, aktiv gegen Klimadesinformation vorzugehen und die Emissionen von Unternehmen strenger zu überwachen und zu regulieren.
Jeder macht beim Klimaschutz, was er will
Wie dringlich solche Richtersprüche sind, zeigt die Weltpolitik jeden Tag: Zwar haben 195 Staaten ihren Weg Richtung Klimaneutralität beim Pariser Gipfel 2015 festgeschrieben, juristische Folgen haben die Beschlüsse der COPs allerdings nicht. Auch zehn Jahre nach dem wegweisenden Abkommen von Paris sind Klimaschutzmaßnahmen und -investitionen politischen Launen und Wirtschaftslagen unterworfen.
Einer der größten Emittenten radiert den Klimawandel einfach aus: US-Präsident Donald Trump führte die USA nach seiner Wiederwahl nicht nur zum zweiten Mal aus dem Pariser Klimaabkommen, sondern schafft Umweltauflagen ab, streicht den Klimabegriff aus sämtlichen offiziellen Dokumenten, stoppt Hilfszahlungen, beendet wissenschaftliche und meteorologische Programme.

US-Klimapolitik Wie belehrt man einen Unbelehrbaren?
Auch in Europa, das sich bisher als Vorreiter inszeniert, wachsen klimaskeptische Tendenzen. So stellte Frankreichs Ministerpräsident Emmanuel Macron die Klimaziele infrage, während Deutschlands Kanzler Friedrich Merz die Rolle der Bundesrepublik beim Klimawandel kleinredete, seine Regierung das Budget für die Dekarbonisierung der Industrie kürzte und stattdessen nach fossilen Energieträgern graben lässt.
Aktuell dürften sämtliche EU-Mitglieder – mit Ausnahme von Finnland und Schweden – die Klimaziele bis 2050 verfehlen. Kürzlich hat die EU-Kommission zwar angekündigt, dass sie – verglichen mit 1990 – ihre Emissionen bis 2040 um 90 Prozent senken möchte. Die Entscheidung wird vor allem von Umweltverbänden heftig kritisiert, weil Länder einen Teil ihrer Emissionen – 140 Millionen Tonnen – mit Klimaschutzprojekten in anderen Ländern kompensieren und dafür sogenannte CO2-Zertifikate erwerben können. Das Umweltbundesamt wertete diesen Emissionshandel als Erfolg, doch es ist unbestritten, dass der Nutzen zahlreicher Aufforstungsprojekte im Globalen Süden selten gegeben ist.

Emissionshandel Noch mal kurz das Klima retten? Über den (Un-)Sinn von CO2-Zertifikaten
Was der IGH ausrichten könnte – und was nicht
Länder wie Vanuatu hoffen nun, dass Klimasünder durch das Gutachten aus Den Haag künftig deutlich stärker zur Rechenschaft gezogen werden. Haupttreiber der globalen Erwärmung könnten etwa dazu verpflichtet werden, ihre Emissionen drastisch zu senken – "und zwar unabhängig von einer Mitgliedschaft im Pariser Klimaabkommen", betont Völkerrechtler Burri. Ungefähr 80 Prozent der Teilnehmer des Verfahrens würden diesen Schritt aktiv unterstützen, zehn Prozent hätten sich dagegen ausgesprochen. Der Rest äußerte sich zwiespältig.
Dass das IGH den sofortigen Stopp aller Emissionen anordnet, gilt allerdings als unwahrscheinlich, weil sich eine solche Forderung derzeit nicht umsetzen ließe.
Wegweisender wäre eine richterliche Entscheidung zu möglichen Konsequenzen für Emittenten, etwa Reparationszahlungen. Selbst wenn die weltweiten Emissionen ab sofort rapide sinken würden, ließen sich die Folgen der Erderwärmung auf lange Sicht nicht stoppen. Besonders vulnerable und arme Länder sind weiterhin von Extremwetterereignissen betroffen, deren Schäden sie kaum bezahlen könnten.

Klimagipfel Deutschland zahlt Millionen an Klimasünder wie China. Wie lange noch?
Eine ähnliche Debatte dominierte auch die letzte Klimakonferenz in Baku, ein konkretes Ergebnis blieb aber aus – sehr zur Enttäuschung der Entwicklungsländer. Der Klimaschutz galt nach dem internationalen Treffen als geschwächt. Die Entscheidung der Richter in Den Haag könnte ihn wieder stärken und die Finanzdebatten bei der anstehenden Klimakonferenz COP30 in Brasilien verkürzen.
Doch der IGH ist kein allmächtiges Organ: Ob seine Entscheidungen auch umgesetzt werden, entscheiden die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Wer das Gericht nicht anerkennt, mit Rügen und Entscheidungen nicht einverstanden ist, beispielsweise Israel oder Russland, der ignoriert den IGH geflissentlich.
Solange die Autorität des Weltgerichts nicht von allen Staatschefs uneingeschränkt anerkannt wird, dürfte das IGH-Gutachten auch den Klimawandel auf lange Sicht nicht aufhalten.
- Klima
- Klimawandel
- Vanuatu
- Tuvalu
- Internationalen Gerichtshof
- Klimakonferenz
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke