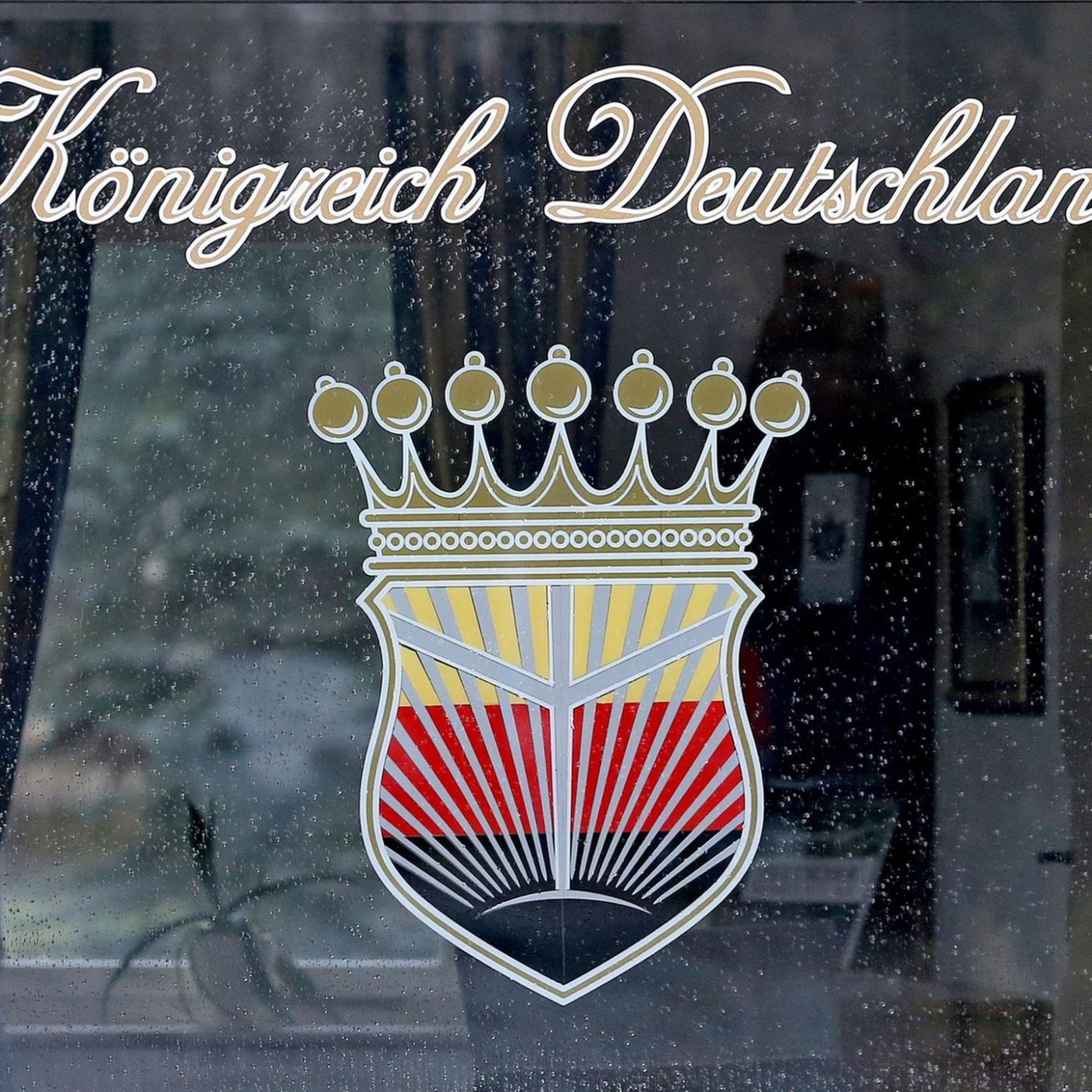Die Stunde der Wahrheit – was Merz nun liefern muss, um glaubhaft zu bleiben
Pass auf dich auf, du kannst mich jederzeit anrufen", sagte Friedrich Merz und schüttelte die Hand von Wolodymyr Selenskyj beim Abschied in Kiew. Vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron gab es sogar eine innige Umarmung und noch einen Kuss auf die Wange für den ukrainischen Amtskollegen. Gemeinsam mit den Premierministern Großbritanniens und Polens, Keir Starmer und Donald Tusk, waren der Bundeskanzler und das französische Staatsoberhaupt am Samstag in die ukrainische Hauptstadt gereist, um ein „starkes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine“ zu setzen sowie europäische Einigkeit gegen den russischen Angriffskrieg zu demonstrieren.
Am Ende des Gipfeltreffens wurde eine am Montag beginnende, bedingungslose 30-tägige Waffenruhe gefordert. Sollte der Kreml diesen Vorschlag nicht annehmen, würde man „eine neue Welle von Sanktionen“ verhängen. Insbesondere verschärfte Maßnahmen im Bereich des Energiesektors und des Bankensystems Russlands.
Wenige Stunden nach der Erklärung der fünf Nationen in Kiew kam prompt die Antwort aus Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin bot zwar direkte Gespräche mit der Ukraine in Istanbul an, die schon am Donnerstag beginnen könnten. Von einer Waffenruhe war nicht die Rede. Das überraschte nicht. Schließlich hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sie bereits Tage zuvor kategorisch abgelehnt. Die Ukraine könne die Zeit nutzen, um Waffen und Truppen an die Front zu bringen sowie neue Soldaten auszubilden, behauptete Peskow.
In Wahrheit wäre die Einstellung der Kampfhandlungen und anschließende Friedensverhandlungen für Russland eine strategische Niederlage. Moskau konnte auch nach drei Jahren Krieg seine Kriegsziele nicht erreichen. Nur 19 Prozent der Ukraine sind in russischer Hand. Weder wurde das Nachbarland „entnazifiziert“, noch konnten die vier ukrainischen Oblaste erobert werden, die Putin per Dekret in die Russische Föderation annektiert hatte.
Die Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter. Am Montag soll es ukrainischen Angaben zufolge insgesamt russische 133 Angriffe gegeben haben. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich die Lage entscheidend ändern würde.
Noch ist unklar, ob es diese Woche – auch ohne Waffenruhe – zu Verhandlungen in Istanbul kommt. US-Präsident Donald Trump hatte Selenskyj aufgefordert, das Angebot Putins anzunehmen. „Zumindest kann man feststellen, ob ein Deal möglich ist oder nicht", sagte Trump. „Und wenn nicht, werden die europäischen Staats- und Regierungschefs und die USA wissen, woran sie sind, und können entsprechend handeln“, fügte er hinzu.
Es ist kaum anzunehmen, dass Putin plötzlich einem Ende des Kriegs zustimmt. Von seinen Maximalforderungen dürfte er nicht abrücken. Dagegen sind nun Merz, Macron, Starmer und Tusk im Zugzwang – wenn sie glaubhaft bleiben wollen. Sie müssten ihre Versprechen einhalten und ein neues Sanktionspaket gemeinsam mit den restlichen der rund 30 Staaten umfassenden „Koalition der Willigen“ verabschieden.
Zudem müsste die militärische Aufrüstung der Ukraine intensiviert werden, was in der Vergangenheit nie ganz gelungen ist. Immer wieder gab es langwierige Diskussionen über die Lieferung verschiedenster Waffentypen. Und selbst als die beschlossen waren, kam es regelmäßig zu Verzögerungen. Europa, aber auch die USA haben es in den vergangenen drei Kriegsjahren versäumt, die Ukraine so umfassend zu bewaffnen, dass sie sich nicht nur verteidigen, sondern auch einen erfolgreichen Gegenangriff gegen russische Truppen führen kann.
Das soll sich nun ändern. Zumindest suggerierten das die Bilder vom Gipfeltreffen in Kiew, mit europäischen Staatsmännern voller Entschlossenheit und Einigkeit. „Putin will mit Maximalforderungen verhandeln und gleichzeitig weiter Krieg führen“, sagte der Sicherheits- und Militärexperte Nico Lange im WELT Fernsehen. „Wenn die Europäer ernst genommen werden wollen, müssen sie nicht nur schöne Bilder produzieren." Gespräche in Istanbul hin oder her – ohne russischen Waffenstillstand, so Lange weiter, müssten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen die angekündigten Sanktionen in Kraft setzen.
Für die „Koalition der Willigen“ ist die Stunde der Wahrheit angebrochen. Es ist an den Europäern, Verantwortung zu übernehmen, während die Trump-Administration weiter unberechenbar bleibt. Sollten die Erklärungen von Kiew wieder einmal nur halbherzig umgesetzt werden, wäre es mit dem Respekt für Europa vorbei. „Merz und die anderen haben über das Wochenende viel Lob bekommen", sagt Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Das kam seiner Ansicht nach zu früh, so richtig ihre Initiative auch gewesen sein mag. „Denn wenn heute, da Russland weiter angreift, keine Folgen kommen, Sanktionen und Unterstützung, löst sich Lob in Luft auf und Merz steht begossen da", schreibt der Professor für internationale Politik auf X.
Nach wie vor bestehen Zweifel am Einsatzwillen europäischer Staaten. Aber begutachtet man die Militärhilfe in den vergangenen beiden Monaten, ergibt sich ein anderes Bild. Allein im März und April umfasste die Unterstützung Europas für die Ukraine etwa 20 Milliarden Euro. So hat Deutschland in diesem Zeitraum der Ukraine unter anderem 80 minenresistente gepanzerte Fahrzeuge (MRAP) geschickt, dazu 282.000 Schuss Munition für Flugabwehrgeschütze, Munition für Gepard-Flugabwehrkanonenpanzer sowie Raketen für die Flugabwehrsysteme IRIS-T und Patriot. Unter Bundeskanzler Merz wird die Ukraine zudem wahrscheinlich auch deutsche Taurus-Marschflugkörper erhalten. Medienberichten zufolge soll die Neuproduktion dieser weitreichenden Waffe bereits anlaufen. Informationen darüber, wann und wie viele geliefert werden, wird es jedoch nicht mehr geben. Die neue Bundesregierung will Details der Waffenlieferungen in Zukunft geheim halten.
Auch andere Staaten kleckern nicht. Großbritannien stellte 1,6 Mrd. Pfund für die Beschaffung von mehr als 5.000 Luftabwehrraketen zur Verfügung. Frankreich schickte weitere gelenkte AASM Hammer Bomben in die Ukraine und sagte zusätzliche Unterstützung in Höhe von zwei Milliarden Euro zu. Schweden hat ein neues Paket im Wert von fast 1,4 Milliarden Euro beschlossen. Die Niederlande werden zwei Milliarden Euro bereitstellen. Belgien kündigte eine Milliarde Euro an und erwägt sogar die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen.
Es ist eine lange Liste von Ländern, die Waffensysteme schicken und auch Finanzmittel für den Ankauf und die Waffenproduktion in der Ukraine zur Verfügung stellen. Die EU soll zudem mehr als eine Million Artilleriegranaten im Jahr 2025 für die Ukraine akquirieren. Die dafür nötigen zwei Milliarden Euro stammen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten.
Die Frage bleibt, ob Europa bereit ist, noch mehr Hilfe zu leisten und in welchem Tempo. Kurzfristig könnten europäische Länder die amerikanischen Waffenlieferungen kurzfristig ersetzen, sofern diese tatsächlich ausbleiben sollten. Mittel- und langfristig dürfte es jedoch Probleme geben, diese riesigen Mengen an Artilleriegranaten, Luftabwehrsystemen und Raketen aller Art zu beschaffen. Experten gehen davon aus, dass es Jahre dauern könnte, bis die dazu nötigen Produktionskapazitäten aufgebaut sind.
US-Militärhilfe läuft aus
Spätestens im Sommer wird die unter der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden genehmigte Militärhilfe auslaufen. Die Trump-Regierung hat der Ukraine nach Unterzeichnung des Rohstoffabkommens zwischen Washington und Kiew zwar einen Einkauf von zusätzlichem Militärequipment zugestanden. Aber der beläuft sich nur auf 50 Millionen Dollar. Bisher bleibt die Lage so: Ohne Unterstützung des Pentagons könnte es schwierig werden, die Ukraine dauerhaft gegen die Angriffe Russlands zu schützen.
Mit der Lieferung von qualitativ überlegenen Waffen, wie etwa des deutschen Marschflugkörpers Taurus, könnte die Kluft aber überbrückt werden. Wohl nur mit einer Intensivierung des Abnutzungskriegs kann die Ukraine den Kreml zu Zugeständnissen am Verhandlungstisch zwingen. Russland soll bisher fast eine Million Soldaten an der Front verloren haben, Verletzte und Gefangene eingerechnet. Die Reserven an gepanzerten Fahrzeugen aus den Depots der Sowjetzeit gehen zur Neige. Internationale Beobachter glauben, dass Moskau ab Mitte dieses Jahres ernsthafte Nachschubprobleme bekommen könnte.
Alfred Hackensberger hat seit 2009 aus mehr als einem Dutzend Kriegs- und Krisengebieten im Auftrag von WELT berichtet. Vorwiegend aus den Ländern des Nahen- und Mittleren Osten, wie Libyen, Syrien, dem Irak und Afghanistan, zuletzt aber auch aus Bergkarabach und der Ukraine. Hier finden Sie alle seine Artikel.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke