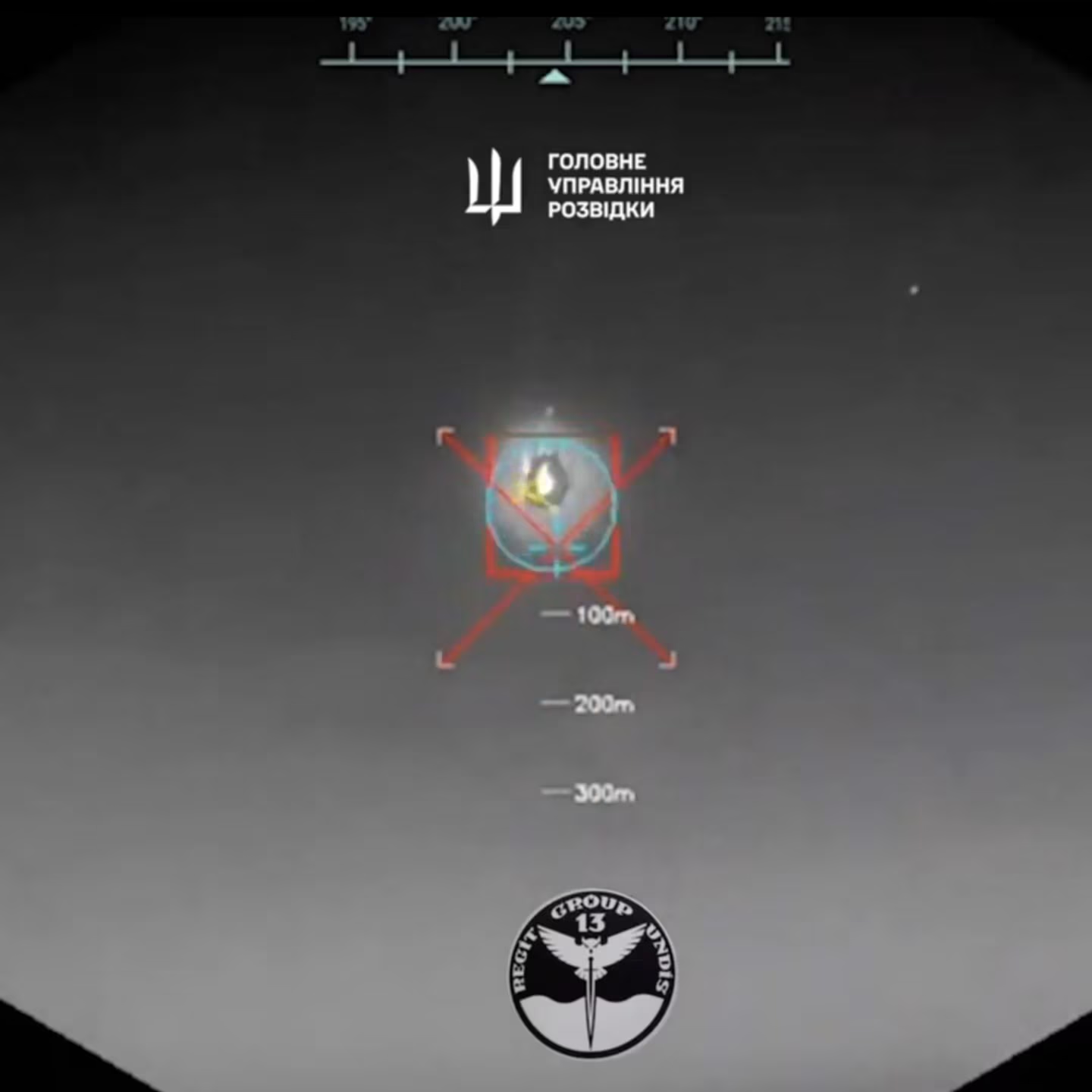„Bürger sagen: Steckt die Millionen lieber in das Freibad als in die Gedenkstätte“
Das Jauchekommando hatte noch nicht lange mit der Arbeit begonnen, da hatten die SS-Männer Max Sachs, einen sächsischen SPD-Politiker und Sohn eines Juden, „schon in die Abortgrube geworfen. Er wurde dann herausgezogen, vollständig entkleidet und nackt in den Waschraum gebracht.“ Kurz darauf wurde Sachs „an den Füßen gepackt und durch den Tagesraum die Treppe hinuntergeschleift“. So zitiert die Website der Gedenkstätte Sachsenburg einen Bericht über die letzten Stunden von Sachs im Konzentrationslager in der Nähe von Chemnitz.
Das KZ Sachsenburg, das von 1933 bis 1937 bestand, ist kaum bekannt, gilt Fachkundigen aber als wichtige Entwicklungsstätte des deutschen Konzentrationslager-Systems. Anna Schüllers Verein Geschichtswerkstatt Sachsenburg dokumentiert auf der Website Insassen-Geschichten. Das KZ, gelegen in der 13.000-Einwohner-Stadt Frankenberg, sei „so eine Art Brücke zwischen den Lagern, die zu Beginn der NS-Diktatur nur kurz, und denen, die viele Jahre bestanden haben, es ist eine Zwischenform“, sagt die Pädagogin. „Es hilft, diesen Prozess zu erklären: Wie konnte es zu Auschwitz kommen?“ Anders formuliert: Wie wurde aus dem Netzwerk der vielen frühen kleinen Zellen- und Folterlager das industrielle Vernichtungssystem der Deutschen?
Doch jetzt droht einem zentralen Gebäude dort der Verfall, die Konsequenz könnte Abriss sein. Und das Aus droht auch der eigentlich geplanten Gedenkstätte vor Ort – bislang existieren besagte Website, ein Ausstellungsraum sowie ein beschilderter „Pfad der Erinnerung“ vor Ort, den die Stadt Frankenberg mit Landesmitteln geschaffen hat. Die alte Villa des KZ-Kommandanten ist bereits abgerissen.
Eine Dokumentations- und Begegnungsstätte wie in bekannten Gedenkstätten, Führungs- und pädagogisches Personal gibt es nicht. Schüller und ihr 19-köpfiger Verein betreuen den Ort seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich, haben im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 600 Besucher, vor allem Schülergruppen, über das Areal geführt. Mit einer Gedenkstätte könnten es viel mehr sein.
„Ohne die Gebäude“ aber, sagt Schüller, „können wir nicht mal mehr Führungen machen. Käme es zum Abriss, würde der Freistaat Sachsen sich ein eigenes Denkmal setzen. Eines das zeigt, dass man sich nicht für die Erhaltung der Erinnerung einsetzt.“ Der Hintergrund: Dem laufenden Bau-Projekt gehen die Gelder vom Land Sachsen aus. Fließen keine neuen, verfallen wiederum angekündigte Bundesmittel. Neues Geld aber ist angesichts extrem knapper Kassen in Sachsen im Haushaltsentwurf bislang nicht vorgesehen; final verabschieden will die schwarz-rote Minderheitenregierung unter Michael Kretschmer (CDU) ihn im Sommer.
Konkret bedroht vor Ort ist jetzt die sogenannte Kommandantur mit den immer noch erhaltenen Folterzellen. „Das Problem ist, das verkennen auch, ich sage es mal so, Parteifreunde aus meiner Partei: Das Kernstück, die Kommandantur, ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand“, sagt Frankenbergs Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU). Man müsse damit rechnen, dass das Gebäude größere Verzögerung im Baubeginn nicht überstehen wird.
Laut Bürgermeister hat das Land „bislang das bezahlt, was wir Teilprojekt 1 nennen: einen Parkplatz etwa, die Infrastruktur außen. Nun steht Bauabschnitt 2 an, wo es darum geht, die wirkliche Gedenkstätte mit Dauerausstellung einzurichten.“ Doch, so Gerstner: „Die 2,5 Millionen des Bundes dafür fließen nur, wenn das Land seine zugesagte Millionensumme gibt. Das Land muss entsprechende Mittel bereitstellen, sonst passiert nichts.“
In der CDU-Landtagsfraktion spielt man den Ball an die Frankenberger zurück, wo es auch Uneinigkeiten über das Wie der Gedenkstätte gab. Aus Fraktionskreisen ist zu hören: Es gibt Irritation darüber, dass neue Mittel gefordert werden. Vor Ort sei der Baufortschritt durch Umplanungen immer wieder verzögert worden. Bis dann feststand, dass die Stadt, die für die Umsetzung verantwortlich ist, es nicht schafft, die bereitgestellten Landesmittel fristgerecht zu verbauen.
Denn die Mittel stammen aus dem sogenannten Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR; daraus sollten 2,5 Millionen Euro fließen – die gleiche Summe, die der Bund geben will. Nur: Das Fördergeld aus dem DDR-Vermögen muss bis zum 31. Dezember vollständig ausgegeben werden. Danach verfällt es. Die Stadt wird bis Jahresende erwartbar aber nur 1,5 Millionen ausgeben. Das heißt: Ein großer Teil der Fördergelder wird somit nicht rechtzeitig abgerufen und verfällt. Eine neue Millionensumme müsste also 2026 aus dem neuen Haushalt bereitgestellt werden.
Das heißt: Neues Geld muss also her für Bauabschnitt 2, egal wer schuld ist. Bürgermeister Gerstner sagte WELT am vergangenen Montag, er hoffe dazu auch auf Oppositionsdruck bei den finalen Haushaltsverhandlungen: Schwarz-Rot hat keine eigene Mehrheit im Landtag.
Am Mittwoch danach dann fand zur Finanzierungs-Frage in Frankenberg ein Treffen statt zwischen Gerstner, Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) und der CDU-Landtagsabgeordneten Iris Firmenich, die sich seit vielen Jahren für die Gedenkstätte einsetzt. Firmenich sagte WELT: „Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir als CDU-Fraktion zur Gedenkstätte in Sachsenburg stehen.“ Die Dreierrunde habe sich „konstruktiv“ durch „alle Details gearbeitet. Es geht darum, dass Projekt zügig fertigzustellen. Es gibt gute Ideen, wie wir das schaffen. Die müssen wir jetzt weiter diskutieren.“
Doch es gibt es auch Widerstand gegen den Plan.
„Für die meisten ein Naherholungsgebiet am Fluss“
Das ehemalige KZ liegt idyllisch am Fluss Zschopau. In der Gegend befinden sich auch das Freibad der Gemeinde und ein Schloss. Vom KZ erhalten ist neben der Kommandantur noch eine alte Spinnerei, in der die Insassen hausen mussten. Mit Baracken wie in Buchenwald oder Auschwitz-Birkenau hatte Sachsenburg äußerlich nichts gemein. Insgesamt waren hier wohl um die 10.000 Häftlinge eingesperrt. 19 Todesopfer sind bislang namentlich bekannt, darunter Sachs; hier wurde früh systematisch mit Prügel „bestraft“.
Der Ort habe „viele Jahre im Dornröschen-Schlaf“ gelegen, sagt Bürgermeister Gerstner. Die Stadtgesellschaft habe den Ort nicht wahrgenommen, mit Ausnahme etwa von Opferverbänden oder der Geschichtswerkstatt. Viele behaupteten über das KZ sogar: Es sei keines gewesen, sondern „maximal ein Schutzhaftlager“ – so lautet eine verbreitete Auffassung laut Gerstner. Tatsächlich war „Schutzhaft“ die übliche Bezeichnung für die Einweisung in ein KZ im Dritten Reich.
„Für die meisten ist es praktisch vor allem die alte Spinnerei und heute ein wunderschön am Fluss gebettetes Naherholungsgebiet am Schloss“, erzählt Gerstner. Und auch um das Freibad gehe es in der Diskussion oft: Auch dieses habe seine „80 Jahre auf dem Buckel“ und bedürfe „einer dringenden Sanierung. Und die Bürger hier sagen: Steckt doch die Millionen lieber in das Freibad als in die Gedenkstätte, denn ‚da war ja eh nichts‘.“ Auch das sei ein Grund, warum es so lange gedauert habe, die Gedenkstätte bis zu diesem Entwicklungsstand voranzutreiben.
Seinen Bürgern nehme er die beschriebene Wahrnehmung aber „gar nicht krumm“, betont Gerstner, denn: „Das Gelände ist halt unscheinbar – man kennt es als schönes Ausflugsziel, reflektiert den Ort aber nicht.“ Er selbst habe dessen Bedeutung „ja erst lernen“ müssen, etwa durch die Arbeit des bei der Stadt angedockten Historikers, dessen Arbeit der Freistaat und die Stiftung Sächsische Gedenkstätten fördern.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Stiftung Verantwortung, Erinnerung und Zukunft zeigt: Vielen Deutschen geht es wie Gerstner damals. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, wenig oder überhaupt nichts über die NS-Verbrechen an ihrem Wohnort zu wissen. Und erstmals seit Beginn der Studienreihe stimmte eine relative Mehrheit der Befragten (gut 38 Prozent) der Forderung nach einem „Schlussstrich“ unter die NS-Zeit zu.
In Sachsen, wo es bislang keine einzige KZ-Gedenkstätte gibt, forderte der AfD-Politiker Björn Höcke in einer Dresdner Rede vor nunmehr acht Jahren eine Total-Umkehr in der Erinnerungspolitik. Der bewusste, offensive Umgang mit der deutschen Täter-Geschichte steht dieser Tage zunehmend infrage, das zeigt nicht nur die Studie.
Im thüringischen Nordhausen etwa, Standort des KZ Mittelbau-Dora, haben CDU und AfD gerade gemeinsam gegen eine Gedenktafel mit den Namen ermordeter Juden gestimmt, wie die „Thüringer Allgemeine“ berichtete. Vor 17 Jahren, als der Stadtrat sich dafür aussprach, dominierten dort SPD und CDU. Heute ist dort die AfD stärkste Stadtratsfraktion.
In Frankenberg gibt es noch eine CDU-Mehrheit. Gerstner warnt: „Für Projekte wie unsere Gedenkstätte läuft langsam die Zeit ab, denn irgendwann fehlen vielleicht die politischen Mehrheiten. Wenn ich meinen Stadtrat oder den Landtag nehme, dann gibt es da gewisse Strömungen, die so etwas wie diese Gedenkstätte ablehnen.“ Das Projekt „wäre sofort tot bei uns, wenn die AfD eine Mehrheit hätte. Entsprechend ist jetzt der Zeitpunkt, und wenn es jetzt nicht kommt, wird es wahrscheinlich nie kommen.“
Jan Alexander Casper berichtet für WELT über innenpolitische Themen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke