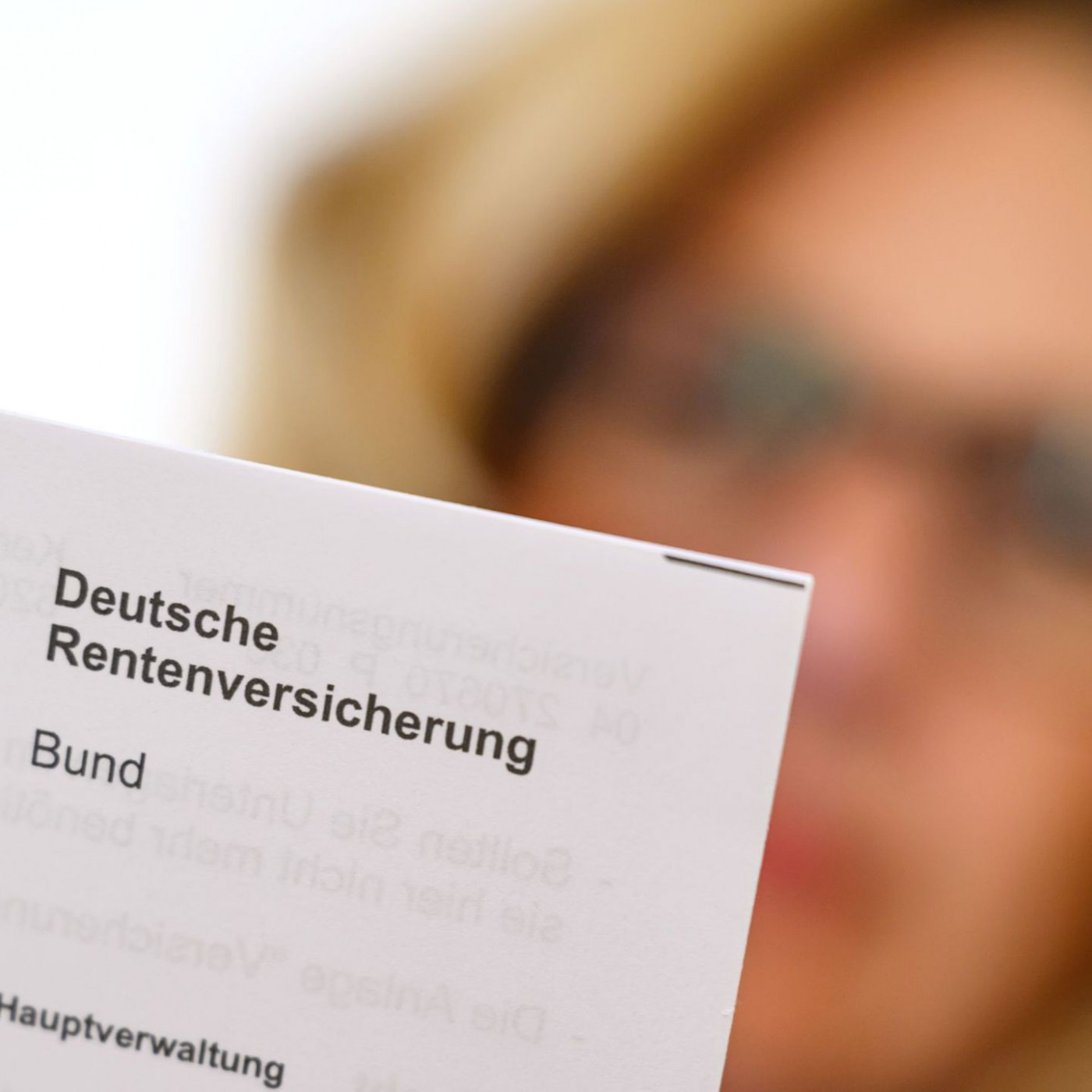„Das merkt man sofort an der Grenze“ – Wo die Angst vor einer Eskalation mit den USA steigt
Am Grenzübergang Puente Internacional Simón Bolívar beginnt der Tag früh. Noch vor Sonnenaufgang stauen sich Passanten auf der Brücke zwischen Kolumbien und Venezuela. Händler bauen ihre Stände auf, Grenzbeamte geben Anweisungen, Koffer rollen über den Asphalt.
Auch in der nahegelegenen kolumbianischen Stadt Cúcuta ist in diesen Tagen deutlich mehr los als sonst. An der Grenze überlagern sich in diesen Tagen zwei unterschiedliche Bewegungen.
Zum einen verlassen weiterhin Venezolaner ihr Land – fliehen vor Armut, Unterdrückung und Perspektivlosigkeit aus der Diktatur des sozialistischen Machthabers Nicolas Maduro, aber auch aus Angst vor einer Eskalation der aktuellen Spannungen mit den USA.
Zum anderen kehren auch mehr Menschen zurück nach Venezuela. Entweder nur für kurze Zeit, um ihre Familien über die Weihnachtsfeiertage zu besuchen. Oder für immer, weil ihre Hoffnungen auf eine Zukunft in den USA sich wegen der harten Grenzpolitik von Präsident Donald Trump zerschlagen haben.
Washington hatte zuletzt hunderttausenden Venezolanern ihren temporären Schutzstatus entzogen, ihnen droht die Abschiebung. Zehntausende Migranten machten auf dem Weg gen Norden wieder kehrt, als die Informationen publik wurden.
Weil im Zuge der aktuellen Spannungen viele Flugverbindungen gestrichen wurden, ist der Landweg über Cúcuta für viele Venezolaner die einzige Möglichkeit, zurück nach Hause zu kommen. Viele der Reisenden, mit denen WELT vor Ort spricht, berichten, dass sie aus den USA kommen.
Wer nach Caracas oder Valencia will, reist über Bogotá in Kolumbien oder Panama City in Panama nach Cúcuta – und geht von hier zu Fuß weiter. Die Warteschlangen werden länger, der Grenzposten kommt an seine Kapazitätsgrenzen.
Rosa Angarita, 44, steht mit einem kleinen Rucksack am Rand der Brücke. Sie ist Venezolanerin und pendelt seit Jahren zwischen den Grenzstädten San Antonio del Tachira und Cúcuta. „So viele Menschen wie jetzt habe ich hier lange nicht gesehen“, sagt sie. „Wenn sich politisch etwas verändert, merkt man das sofort an der Grenze.“
Tatsächlich ist die Lage in der Region angespannt, seitdem die US-Regierung unter Präsident Donald Trump in der Karibik Jagd auf vermeintliche Drogenboote aus Venezuela und Kolumbien macht. Zwar verfolgt Washington schon seit 2019 eine harte Sanktionspolitik gegen Maduro und seine sozialistische Diktatur, vor allem gegen den Ölsektor – die wichtigste Einnahmequelle des Landes. Inflation, Versorgungsengpässe und Armut prägen den Alltag vieler Menschen.
Zuletzt haben sich die Spannungen aber verschärft: Die USA beschlagnahmten mehrere sanktionierte venezolanische Öltanker und kündigten an, künftig weitere Schiffe zu blockieren. In Caracas wird das als feindlicher Akt gewertet.
Viele Venezolaner, die im Ausland leben, fürchten, dass sich die politische und wirtschaftliche Lage weiter zuspitzt – und selbst kurze Reisen in die Heimat bald unmöglich werden. „Deshalb fahren wir jetzt“, sagen viele, die die Grenze passieren.
Rosa Angarita arbeitet normalerweise an einem Essensstand auf der kolumbianischen Seite. Heute ist sie unterwegs, um Medikamente zu besorgen. Wegen der angespannten Lage will sie so schnell wie möglich nach Hause zurück. „Viele haben Angst – wegen Venezuela. Aber auch wegen dem, was hier passiert.“
Denn auch auf kolumbianischer Seite ist die Nervosität groß. In den vergangenen Tagen hatte die Guerillaorganisation ELN zu bewaffneten Aktionen aufgerufen. Anwohner wurden gewarnt, Orte mit Polizeipräsenz zu meiden. In der Region waren zuletzt mehrere Autobomben entdeckt worden. Schnell weg hier, denken sich daher viele, die Cúcuta passieren müssen.
Die Migration hat sich verändert
Am Flughafen Camilo Daza warten dutzende Reisende aus den USA auf Taxis in Richtung Grenze. Manche tragen noch Winterkleidung, andere halten Geschenke in den Händen. Kaum jemand bleibt in Cúcuta. Taxifahrer Álvaro Mejía, 62, ist seit mehr als 30 Jahren in der Region unterwegs. „Früher waren es ein paar Fahrten am Tag“, sagt er. „Jetzt sind es 15 oder 20. Fast alle kommen aus den USA. Niemand bleibt hier – alle wollen nach Venezuela.“
Viele seiner Fahrgäste erzählen allerdings, dass sie nur für wenige Tage in die alte Heimat reisen. Ob sie danach so einfach zurück in die USA können, wissen sie selbst nicht genau, seitdem Präsident Trump die Migrationspolitik massiv verschärft hat.
Sie hoffen, dass ihre Papiere noch gelten. Sicher ist sich aber kaum jemand. Und doch gehen viele das Risiko ein, aus Sorge, ihre Familien für lange Zeit nicht mehr sehen zu können.
In einer Apotheke sucht Karen Parra, 31, nach Insulin für ihre Mutter in Venezuela. Seit Jahren kauft sie Medikamente in Kolumbien und bringt sie über die Grenze. „Es wird schwieriger“, sagt sie. „Heute gab es weniger als letzte Woche.“
Auch Hilfsorganisationen spüren, dass sich etwas verändert hat. Maria Mercedes Gonzales, Mitgründerin einer Organisation für junge Venezolaner in Cúcuta, beobachtet die Entwicklung mit Sorge. „Früher war klarer, wer flieht“, sagt sie. „Jetzt kommen manche, gehen wieder, kommen zurück. Die Migration ist chaotischer geworden – und niemand scheint einen Überblick zu haben.“
Im September hatten Kolumbien, Panama und Costa Rica auf einer Konferenz in Bogotá berichtet, dass die Hauptmigrationsroute gen Norden durch den Darien-Dschungel praktisch versiegt sei. Zehntausende Menschen, die die USA verlassen mussten oder es gar nicht bis zur Grenze geschafft hatten, seien auf dem Rückweg, viele stranden in Transitländern wie Mexiko oder Kolumbien. Die Nachfrage nach Hilfe steigt, während die staatliche Unterstützung kaum Schritt hält.
Daher wächst auch der Unmut in der einheimischen Bevölkerung. Cúcuta ächzt unter der hohen Zahl an Durchreisenden und Geflüchteten. Immer mehr Kolumbianer haben das Gefühl, dass die Situation außer Kontrolle gerät.
Pamela, eine Anwohnerin, die ihren Nachnamen für sich behält, sagt: „Ich mache mir große Sorgen um die Sicherheit. Viele haben nichts zu tun, keine Chancen – und das führt zu Problemen. Das ist hier so, aber auch im ganzen Land.“
Cúcuta ist seit Jahren ein Knotenpunkt der venezolanischen Migration. Doch was sich derzeit abspielt, ist neu: Flucht und Rückkehr passieren gleichzeitig. Hoffnung und Angst treffen aufeinander – auf engstem Raum.
Als es dunkel wird, leuchten die Lampen auf der Brücke auf. Sicherheitskräfte beobachten das Geschehen, Händler packen zusammen. Morgen früh wird es wieder losgehen. Mit neuen Bussen, neuen Gesichtern – und der bangen Frage, wie lange die Grenze diesem doppelten Druck noch standhalten kann.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke