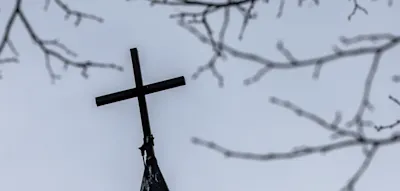„Den schmutzigen Kopf abschlagen“, droht China und schickt Kriegsschiffe nach Japan
Noch vor wenigen Wochen stand Sanae Takaichi neben Xi Jinping auf einer Bühne in Südkorea, höflich lächelnd, fast gelöst. Es wirkte wie der Auftakt eines vorsichtigen Neustarts zwischen Japans neuer Premierministerin und Chinas Generalsekretär. Nun, keine dreißig Tage später, spricht ein chinesischer Diplomat davon, der japanischen Premierministerin „den schmutzigen Kopf abzuschlagen“.
Niemand hat erwartet, dass es zwischen den historischen Erzfeinden China und Japan harmonisch laufen würde. Doch Pekings Worte sind nicht nur ausgesprochen drastisch, sondern stehen auch für die Rückkehr einer Außenpolitik, die Peking eigentlich zurückfahren wollte: der sogenannten Wolf-Warrior-Diplomatie. Doch Peking belässt es nicht allein bei scharfen Worten.
Die Wolfskrieger-Diplomatie ist ein außenpolitischer Stil, der nicht auf Deeskalation setzt, sondern auf Konfrontation: aggressive Wortgefechte, persönliche Attacken, öffentliche Drohungen. Eine Diplomatie, die nicht beschwichtigt, sondern einschüchtert. Ein einziger Satz erweckte sie wieder zum Leben. Takaichi erklärte im Parlament, ein Angriff Chinas auf Taiwan könne eine „das Überleben Japans bedrohende Situation“ darstellen. Eine nüchterne Einschätzung aus Sicht Tokios.
Denn Taiwan liegt nur rund 100 Kilometer von japanischem Territorium entfernt. Taiwan kontrolliert Seewege, die für Japans Wirtschaft essenziell sind und ist seit Jahren ein neuralgischer Punkt der regionalen Sicherheit. Doch für Peking ist Taiwan ein innerchinesisches Thema: Es soll mit dem chinesischen Festland „wiedervereinigt“ werden. Und jeder Hinweis eines Nachbarstaates auf mögliche militärische Konsequenzen wird als Anmaßung verstanden.
Peking reagierte auf die Äußerungen Takaichis zunächst formell. Der japanische Botschafter wurde einbestellt, es gab die üblichen Formulierungen über „Einmischung in nationale Angelegenheiten“. Doch die Sprache kippte schnell in ein anderes Register. Xue Jian, der Generalkonsul in Osaka, schrieb auf X in japanischer Sprache, der „schmutzige Kopf“, der sich einmische, müsse „ohne Zögern abgeschlagen“ werden. Ein Satz, der in Japan wie eine Drohung auf höchster persönlicher Ebene ankam.
In den Tagen danach rollte eine Welle nationalistischer Kommentare über Pekings Informationskanäle. Takaichi wurde als „Hexe“, „Zündlerin“ und „Unruhestifterin“ bezeichnet. Der Staatssender CCTV erklärte, wer sich in Fragen Taiwan „einmische“, schaufle „sein eigenes Grab“. Andere Kommentatoren zogen Vergleiche zur japanischen Invasion in China 1931. Taiwan steht in dieser Geschichte an einer besonderen Stelle. Von 1895 bis 1945 war die Insel eine japanische Kolonie. Viele Taiwaner jener Zeit fühlten sich Japan kulturell näher als China. Die Volksrepublik deutet dieses Kapitel jedoch anders: Für Peking ist die Rückgabe Taiwans 1945 ein Akt der historischen Gerechtigkeit. Deshalb gelten japanische Aussagen zu Taiwan als Eingriff in eine empfindliche Zone chinesischer Identität.
China ließ jedoch auch seine machtpolitischen Muskeln spielen, um seinen Unmut über die unerwünschten Aussagen der japanischen Regierungschefin zum Ausdruck zu bringen. Am Wochenende schickte Peking einen Verband seiner Küstenwache in Japans Hoheitsgewässer rund um die Senkaku-Inseln. Diese werden von Tokio kontrolliert und auch von China beansprucht.
Der Anspruch, eine „starke Nation“ zu sein
Dass Peking außenpolitische so ungeniert auf Eskalation gegen jene setzt, deren Positionierung nicht gefallen, hat jedoch nicht nur historische Gründe. Es ist auch Ausdruck einer Verschiebung der machtpolitischen Kalkulation des Politbüros. Unter Deng Xiaoping galt die Leitformel „Verberge deine Stärke und warte ab“, eine Doktrin, die China ab den Achtziger- bis in die frühen Zweitausenderjahre prägte. Es ging um wirtschaftliche Öffnung, internationale Integration und Konfliktvermeidung.
2012 änderte sich die Grundhaltung mit dem Machtantritt Xi Jinpings. Der Anspruch, eine „starke Nation“ zu sein, wurde zentral. Es entstand 2017/2018 eine Wolfskrieger-Mentalität – befeuert durch den Konflikt mit den USA, wachsendes Selbstbewusstsein im Inland und die wachsende Rolle sozialer Medien. Diplomaten wie Zhao Lijian griffen erstmals öffentlich ausländische Regierungen an, Botschaften lieferten sich Wortgefechte, und Kritik an China wurde offensiv und teils beleidigend zurückgewiesen. Ihren Höhepunkt erreichte die Wolf-Warrior-Rhetorik 2020 und 2021 während der Pandemie, als Peking sich global isoliert fühlte und aggressiv zurückschlug. Peking beließ es damals jedoch stets bei rhetorischen „Schlägen“.
Ab 2022 folgte eine sichtbare Mäßigung. Die Pandemie hatte Chinas internationales Ansehen beschädigt, die Wirtschaft schwächelte und Xi suchte neue Stabilität in den Beziehungen zu Europa und Asien. Staatsmedien dämpften ihren Ton. Eine KI-gestützte Analyse des „Economist“, für die zehntausende Statements ausgewertet wurden, zeigt diesen Rückgang klar: Der Aggressionsindex fiel nach 2021 kontinuierlich und lag Anfang 2025 so niedrig wie seit fast sechs Jahren nicht mehr.
Die neue Eskalation gegenüber Japan zeigt nun, wie fragil diese Phase der Mäßigung war. Unter dem Eindruck wachsender geopolitischer Konkurrenz erlaubt sich Peking wieder eine bewusst einschüchternde Sprache. Sie mobilisiert patriotische Gefühle, lenkt von inneren Problemen ab und signalisiert der Region, dass China seine Kerninteressen entschlossener durchsetzt als zuvor. Es ist weniger ein Kurswechsel als eine Rückkehr zu einem Stil, der nie ganz verschwunden war – und den die Führung jetzt wieder als nützlich erachtet.
Hinzu kommt die realpolitische Machtdurchsetzung. Zu spüren bekam sie nicht nur Japan mit dem Eindringen chinesischer Schiffe ins eigene Hoheitsgebiet. Auch Deutschlands Außenminister Johann Wadephul musste jüngst erfahren, was seit Neustem dem widerfährt, der China bei seinen Kerninteressen verärgert. Der CDU-Minister hatte Peking gegen sich aufgebracht, indem er vor einer chinesischen Aggression gegen Taiwan warnte.
Die Folge war eine diplomatische Klatsche. Wadephul wollte seinen Antrittsbesuch im Reich der Mitte absolvieren, aber außer seiner Amtskollegen verweigerten ihm die chinesischen Offiziellen die Gesprächstermine.
Auch gegenüber den mächtigen USA legte China plötzlich harte Bandagen an. Zoll-Drohungen des US-Präsidenten wurden reziprok ergänzt und Xi Jinping zog das schärfste Schwert bislang: Er verhängte Export-Beschränkungen für Seltene Erden. Ein Rohstoff, der nicht nur für die amerikanische Wirtschaft, sondern auch die europäische in allen Branchen – von Automobil bis Rüstung – von höchster Relevanz ist.
Dass China neben der Rhetorik nun auch seine realpolitische Macht einsetzt, ist Ausweis eines neuen Selbstbewusstseins in Peking. Und der Erkenntnis, dass China mittlerweile so mächtig geworden ist, dass es sich nicht mehr verstecken und die Verletzung seiner Kerninteressen, wie es stets heißt, nicht mehr hinnehmen muss.
Christina zur Nedden ist China- und Asienkorrespondentin. Seit 2020 berichtet sie im Auftrag von WELT aus Ost- und Südostasien.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke