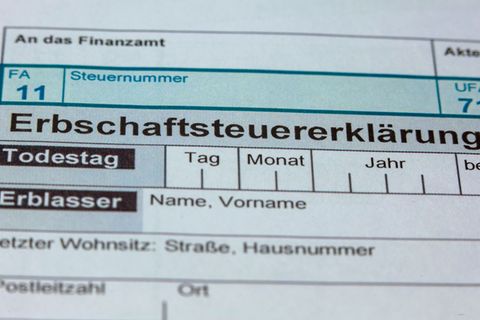„Diese Leute haben noch nie in ihrem Leben mit einem Grünen gesprochen“
Das Freibier ist ausgetrunken um viertel vor elf am Freitagabend auf dem Ost-Kongress der Grünen in Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Ein paar Dutzend Teilnehmer spielen noch Kneipenquiz mit Fragen wie: Wie hieß das „Titanic“-Cover-Girl „Zonen-Gabi“ wirklich? Oder: Zu welchem Preis ging damals das VEB Faserplattenwerk Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern an den Hamburger Kaufmann Eduard Kynder?
Die jüngste Umfrage aus Sachsen-Anhalt sieht die Grünen bei drei Prozent, bei der Landtagswahl 2026 könnten sie aus dem Parlament fliegen wie zuletzt in Thüringen und Brandenburg. Die AfD liegt vorn, weit dahinter folgt die CDU. Auf dem Kongress – 480 Anwesende, davon circa 100 keine Grüne – geht es um die Krise der Partei im Osten und mögliche Gegenmittel, er ist aber auch eine Fortbildung Ost für Neumitglieder und West-Grüne.
Etwas weniger als die Hälfte der Grünen hier kommt aus Westdeutschland inklusive Berlin, es gibt ein „Onboarding Ostdeutschland“, eine ehemals „Bürgerbewegte“ erklärt den Zusammenhang zwischen DDR-Propaganda und Russland-Nähe heute. „Bündnis 90“ und die grüne Bürgerrechtsgeschichte sollen stärker ins Mitgliederbewusstsein rücken, die Landespartei hat überall Becher und Schilder verteilt mit einem blau-grünen „Bündnis 90/Die Grünen“-Logo aus der Nachwendezeit, dazu der Slogan: „Mutig seit 1989“. Die designierte Spitzenkandidatin im Land, Susan Sziborra-Seidlitz, erzählt häufig an diesem Wochenende, dass sie im Wahlkampf auf einer Elektro-Schwalbe durchs Land fahren wird – der Elektroversion des berühmten DDR-Mopeds.
Der Versuch ist offenbar, traditionsbewusst und ökologisch zugleich zu sein, Bürgerrechtsgeschichte und Heimatliebe zu verbinden. Das könnte auch eine Antwort sein auf die bei den Grünen zuletzt häufig vorgetragene Analyse, die eigenen Angebote seien zu technokratisch. Aber diese Symbolpolitik ist umstritten. Am Freitagabend etwa, Hauptbühne, Auftaktgespräch: Wolfram Günther, Ex-Energie- und Klimaminister von Sachsen, fragt, welche „Narrative“ das bedienen solle. Er will lieber „strukturelle Fragen“ aufgreifen, die folgende Analyse machen viele auf dem Kongress: Der Osten als „Werkbank“ der Republik, wo fast keine Konzernzentrale steht und wo im Krisenfall Stellen zuerst gestrichen werden. Die Arbeitslosenzahlen steigen; die Grünen setzen dagegen immer wieder die Hoffnung auf Jobs durch grüne Innovation.
In ihrer Begrüßungsrede erklärt die einzige Wittenberger Grünen-Stadträtin, Sandra Lüder, ihre Partei – sehr realohaft – zur „politischen Kraft des Mittelstands“, erntet dafür kräftigen Applaus, und schwärmt dann – wie vor ihr Parteichefin Franziska Brantner – vom Wittenberger Batteriespeicher-Startup Tesvolt. Grün, regional, digital.
Wirtschaftsschlagzeilen machte Sachsen-Anhalt zuletzt aber vor allem mit dem gescheiterten Intel-Ansiedlungsprojekt von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck. Seine Bundes-Grünen sind in den Augen mancher Kongressteilnehmer primär für die Ostschwäche der Partei verantwortlich. Läuft es auf der Bundesebene, läuft es auch im Osten, so schreiben die ostdeutschen Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta und Julia Schneider in einem zum Kongress veröffentlichten Papier. Aber: „Umgekehrt“ könne man vor Ort so gut wie gar nichts ausrichten gegen den Flurschaden, wenn die Bundespartei „Verengung auf die Kernklientel“ betreibe – laut Papier Akademiker und Gutverdiener. Für jene biete man derzeit Identifikationsfiguren, kaum aber für „Arbeiterkinder, Nicht-Akademiker:innen und Ostdeutsche“.
„Wir haben nicht so viel falsch gemacht“
Schärfer noch sagt es Steffi Lemke am Freitagabend, die einzige Grüne im Bundestag aus Sachsen-Anhalt und Ex-Umweltministerin. Zum Auftaktgespräch auf der Hauptbühne sitzt sie neben Wolfram Günther, außerdem nimmt auch Britta Haßelmann, Co-Fraktionschefin im Bundestag, teil. Die Moderatorin bittet zum Schluss alle drei um positive Gedanken. Lemke fällt dazu ein: „Wir haben nicht so viel falsch gemacht. Wir waren bis vor Kurzem in vier ostdeutschen Landesregierungen, wir waren in allen ostdeutschen Landtagen“, in Sachsen-Anhalt sei man von 350 auf 1700 Mitglieder gewachsen. Rausgeflogen aus den Landtagen sei man nicht, „weil Wolfram (Günther, d. Red.) ein schlechter Umweltminister war“, sagt sie – sondern weil „wir in der Bundespolitik Fehler gemacht haben“.
Haßelmann greift dann das Mitgliedermotiv auf: 168.000 Grüne gebe es nun. „Warum haben wir so viele Mitglieder in so kurzer Zeit gewonnen? Weil die Leute das Gefühl haben, sie schließen sich wem an, der und die, finde ich, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, verteidigt – die wollen mittun, die wollen mitmachen, sich einbringen, und das ist ein wahnsinnig stützendes Signal für uns.“ Hier macht Haßelmann eine Atempause, ideal, um den Mitgliederzuwachs zu beklatschen. Allein im Osten ohne Berlin verdoppelten sich die Grünen in sechs Jahren beinahe, von knapp 7800 im Jahr 2019 auf 12.542 Mitglieder heute.
„Wäre ja schön, wenn sie mittun würden“
Doch niemand applaudiert an dieser Stelle, stattdessen Gemurmel im Zuschauerraum vorne links: „Wäre ja schön, wenn sie ‚mittun‘ würden“, sagt dort ein Grüner aus Sachsen. Bei 50 Neumitgliedern könne man sich über drei, vier Aktive schon freuen. Drumherum nicken einige Thüringer Grüne, und um das Problem geht es auch am Samstag im Workshop „Grün aktiv im ländlichen Raum“. Im Seminarraum vorn leitet die Fraktionschefin im Magdeburger Landtag, Cornelia Lüddemann, knapp drei Dutzend Teilnehmer durch das Programm, zwischendurch sollen sie sich in Kleingruppen besprechen.
In einem Stuhlkreis sitzen einige Männer, einer trägt Jeans-Rock und Kuschelpullover, ein anderer ist in Schwarz gekommen, mit Vollbart und Wikinger-Frisur. Sie stellen sich einander vor, dabei stellen zwei der Männer fest, dass sie aus dem Thüringer Ilm-Kreis stammen. Hier begegnen sie sich zum ersten Mal.
„Ich bin dein Sprecher“, sagt der Ältere. Der Jüngere entgegnet entschuldigend: Er sei erst seit Kurzem bei den Grünen – seit Jahresanfang. Ein Dritter moniert: „Das ist nicht kurz.“ Als es in der Großgruppe weitergeht, fordert diese Kleingruppe „Hilfe bei der Mitglieder-Aktivierung“. Sie stellen auch fest: Viele ihrer Verbandsmitglieder seien über 70 Jahre alt oder Zugezogene, wenig mobil im großen Flächenlandkreis oder dort kaum verwurzelt. Beides erschwere die politische Arbeit – ganz abgesehen vom Zögern, sich überhaupt als Grüner zu erkennen zu geben.
„Ein Problem ist oft das ‚Branding‘ als Grüner“, sagt ein Mann, der sich meldet im Seminarraum – „die Leute wollen sich nicht outen“. Carolin Renner, die junge Vorsitzende des Kreisverbands Görlitz, die vorn mit Lüddemann auf der Bühne sitzt, sagt, sie sei aus Görlitz weggezogen, weil sie es „einfach nicht mehr ausgehalten“ habe „mit den ständigen Anfeindungen“. Die geschilderten Erfahrungen und Forderungen pinnt eine Helferin in Karteikärtchenform an eine Stellwand, das Muster ist bekannt: Ohnehin wenige Grüne im Osten haben kaum Kontakt zu parteipolitisch fremden Milieus oder ziehen sich zurück, in der Abwesenheit blühen Vorurteile.
Schon ein wenig Annäherung gilt als Erfolg, so beschreibt es Tobias Kremkau, ein Mann mit langem Strubbelbart, der neben Lüddemann und Renner sitzt und erzählt: Vor drei Jahren sei er aus Berlin Friedrichshain-Kreuzberg nach Stendal im Norden Sachsen-Anhalts gezogen, dort ist er Kreisvorsitzender des Verbands Altmark: Circa 80 Grüne auf einer Fläche doppelt so groß wie das Saarland, sagt Kremkau.
In Vereinen, denen er dort beigetreten sei aus privaten Gründen, habe er „immer festgestellt: Diese Leute haben noch nie in ihrem Leben mit einem Grünen gesprochen.“ Als „rauskam“, dass er Grüner sei, habe es „lange Gesichter“ gegeben: „Wie kann das denn sein? Du bist doch so sympathisch“ zitiert er, im Seminarraum bricht Gelächter aus.
„Grüne sind auch normale Menschen“
Heute fragten ihn dieselben Leute darüber aus, wie der letzte Grünen-Parteitag gelaufen sei, das Interesse sei gewachsen. „Die wählen wahrscheinlich immer noch nicht grün“, sagt Kremkau, „aber sie wissen inzwischen: Man kann einen Grünen kennen und mögen, und das sind auch normale Menschen.“
Die Geschichte dürfte im Sinne seines Co-Parteichefs Felix Banaszak sein, der zum Kongress-Auftakt vor der Kirche mit den Luther-Thesen eine „Präsenz-Offensive, die nicht hier startet und auch auf gar keinen Fall hier endet“, ausgerufen hatte. Vorher hatte er noch mit drei der wenigen Unter-18-Jährigen dort für ein Foto posiert. Die Grünen werden sich trotz allen Gegenwinds von „nichts und niemandem“ aus „dem öffentlichen Raum vertreiben“ lassen, sagte Banaszak.
Manche auf dem Kongress verbinden noch viel größere Hoffnungen mit grüner „Präsenz“. Wolfram Günther zufolge sei es „ein Unterschied, ob ich irgendwo im ländlichen Raum einen Marktplatz habe und da ist ein AfD-Büro – oder da sind Grüne präsent“. Der „Fakt, dass so etwas Zivilisiertes, Positives, Zukunftsgerichtetes wie Bündnisgrüne dort da sind“, könne junge Familien zum Bleiben und zum Aufbau einer Existenz bewegen, sagt Günther. „Deswegen sind wir die gute Botschaft.“
Jan Alexander Casper berichtet für WELT über die Grünen und gesellschaftspolitische Themen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke