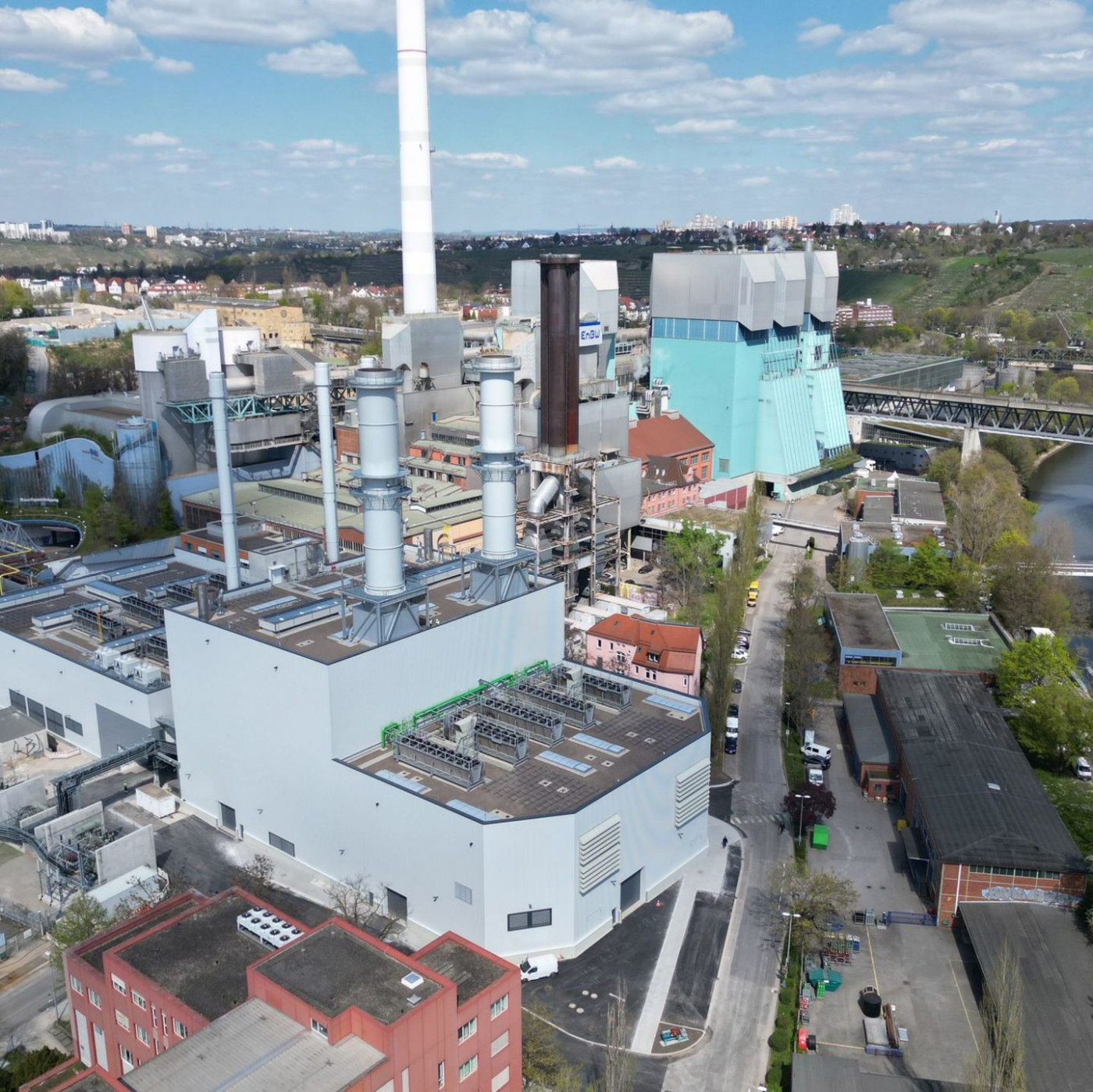Jetzt zerbricht ein „leuchtendes Beispiel“ für jüdisch-muslimische Verständigung
Zehn Jahre lang galt der „Runde Tisch Frieden“ in Köln-Chorweiler als Vorzeigeprojekt. Protestanten, Katholiken, Muslime, Juden, Aleviten – sie alle saßen zusammen, beteten, suchten den Austausch. Sogar eine eigene Friedensglocke wurde gegossen, als Symbol für Respekt und Verständigung. Chorweiler, ansonsten ein sozialer Brennpunkt, sollte dadurch zum Vorbild für interreligiösen Dialog werden.
Nun ist die Eintracht dahin. Abraham Lehrer, 69, Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, erklärte den Austritt seiner Gemeinde aus dem Projekt: „Dass der Ministerpräsident zum zehnjährigen Jubiläum kommt, war allen Mitgliedern schon länger bekannt, und alle haben sich gefreut“, erzählt er im Gespräch mit WELT. „Aber plötzlich wurde das mit dem Krieg in Gaza verknüpft und Wüst als Kriegsverbrecher hingestellt. Das war für uns nicht akzeptabel.“
Geplant war ein Auftritt des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) am 1. September, dem Jubiläumstag der Initiative und zugleich Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Wüst sollte beim „Abendfrieden“ sprechen, einer interreligiösen Andacht für Gebet und Austausch. Die Teilnahme wurde öffentlich angekündigt, Flyer wurden gedruckt.
Doch wenige Tage vor dem Termin kippte die Stimmung. Beim Bürgerzentrum Chorweiler, auch Teil des Runden Tisches, trafen mehrere E-Mails ein. Zunächst war von parteipolitischem Missbrauch die Rede, die CDU wolle das Friedensgebet für den Kommunalwahlkampf instrumentalisieren.
Kurz darauf verschärfte sich der Ton: In einer Mail wurde die Einladung Wüsts, laut Lehrer, als „Skandal“ bezeichnet, verbunden mit dem Vorwurf, er stehe für eine „bedingungslose Unterstützung Israels, eines Staates, der im Gazastreifen Völkermord und Apartheid begehe“. Schließlich sei auch eine Drohung gefolgt, eine Gegendemonstration mit 50 Personen zu organisieren, sollte der Ministerpräsident nicht ausgeladen werden, wie Abraham Lehrer erzählt.
„Wir wissen nicht, wer diese Mails verfasst hat“, sagt Lehrer. „Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auch aus dem Kreis des Runden Tisches stammen, sonst hätte das Bürgerzentrum sie nicht an alle Mitglieder weitergeleitet.“ Die Synagogen-Gemeinde habe reagiert: „Wir haben eine eigene Mail verschickt und gesagt: Das kann es doch nicht sein. Die Friedensglocke hat nichts mit Gaza zu tun. Aber es kam nichts zurück. Keine einzige Organisation hat sich solidarisch mit uns gezeigt. Da blieb uns nur noch der Austritt.“
Lehrer kritisiert weiter, dass die gesamte Kommunikation an der Synagogen-Gemeinde vorbeigegangen und diese dadurch aus der Diskussion ausgeklammert geblieben sei. Besonders empörte ihn, dass der Runde Tisch bereits am Montagabend das Emblem der Gemeinde von seiner Internetseite entfernte – noch bevor der Austritt bei einer Pressekonferenz am Dienstag offiziell verkündet wurde. Für Lehrer war das ein Akt „vorauseilenden Gehorsams“. Das Bürgerzentrum Chorweiler, über das die Mails weitergegeben wurden, äußerte sich auf WELT-Anfrage nicht zu dem Vorgang.
Obwohl der „Abendfrieden“ abgesagt wurde, kam Ministerpräsident Wüst dennoch nach Chorweiler. Gemeinsam mit dem Kölner Oberbürgermeister-Kandidaten der CDU, Markus Greitemann, besuchte er das Begegnungszentrum der Synagogen-Gemeinde. Dort betonte Wüst, wie wichtig der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland sei.
„Solidarität bröckelt“
Die Stadt Köln hatte den Runden Tisch Frieden ursprünglich für den Ehrenamtspreis „KölnEngagiert 2025“ vorgesehen. Die Jury hatte die Initiative als Preisträger für den „Miteinander-Preis für Demokratie und Vielfalt“ ausgewählt. Nach dem Austritt der Synagogen-Gemeinde wenige Tage vor der Preisverleihung setzte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) die Übergabe vorläufig aus.
Bereits zuvor hatte die Synagogen-Gemeinde in einem Schreiben an Reker eindringlich gefordert, die Preisverleihung abzusagen. Die Gemeinde argumentiert, dass die Initiative durch den Einfluss propalästinensischer Stimmen ihren überparteilichen Charakter verloren habe. Besonders schwer wiege der Umgang mit dem angekündigten Besuch Wüsts, der lange vorbereitet gewesen sei und schließlich unter dem Eindruck des Gaza-Kriegs abgesagt wurde. Eine Ehrung der Initiative, so der Vorstand, käme einer nachträglichen Legitimierung gleich und würde das Vertrauen in die Stadt beschädigen.
Abraham Lehrer begrüßt daher Rekers Entscheidung: „Die Stadtspitze hat sofort reagiert. Mehr konnte sie in dieser Situation nicht tun“ Für den Vorsitzenden der Synagogen-Gemeinde ist der Konflikt mehr als nur ein lokaler Streit. „Der Vorfall bestätigt den Trend in Deutschland, dass die Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft stark bröckelt.“
Besonders deutlich sei der Bruch bei einem Treffen mit jüdischen Jugendlichen seiner Gemeinde gewesen, erzählt Lehrer. „Kinder, die auf jüdische Schulen gehen, hatten nichts zu berichten. Aber die, die auf andere Schulen gehen, erzählten wie ein Wasserfall – von Mobbing, Diffamierungen, Antisemitismus. Da waren Geschichten dabei, bei denen einem wirklich übel wird.“ Auch jüdische Erwachsene spürten Distanzierung im Alltag. „Immer häufiger hören wir, dass Arbeitskollegen oder Freunde sagen: ‚Du bist Israel-Anhänger, ich bin Gegner, lass uns getrennte Wege gehen.‘“
Am Runden Tisch in Köln-Chorweiler sitzen aktuell neben katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirchenverbänden die Alevitische Gemeinde Köln sowie die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib). Während die christlichen Vertreter in der Regel beim Thema Nahost-Krieg zurückhaltend agieren und die Aleviten traditionell Distanz zu Islamisten wie der Hamas wahren, gilt Ditib Kritikern als verlängerter Arm der türkischen Regierung. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich mehrfach offen an die Seite der Hamas gestellt und Israel mit scharfen Worten attackiert.
Ditib steht bundesweit unter Druck. Das Bundesinnenministerium forderte den Verband jüngst dazu auf, sich klar gegen Islamismus und Antisemitismus zu positionieren. „Wir erwarten eine eindeutige Distanzierung von Organisationen und Personen, die antisemitische Narrative verbreiten oder islamistische Bestrebungen unterstützen“, sagte ein Ministeriumssprecher WELT.
Auslöser war eine Konferenz islamischer Gelehrter in Istanbul, deren Teilnehmer in einer Resolution den bewaffneten Kampf der Hamas unterstützten und zu einem „weltweiten Dschihad“ aufriefen. Ali Erbas, Präsident der türkischen Religionsbehörde Diyanet (deutsch: Präsidium für religiöse Angelegenheiten), war Teilnehmer und Redner auf der Konferenz. Diyanet ist Erdogan direkt unterstellt. Das Bundesinnenministerium sprach von einem „erneuten Beleg für die problematische Anbindung von Ditib an die türkische Religionsbehörde“.
„Ob Ditib zu den Absendern der Protestmails gehörte, weiß ich nicht“, sagt Lehrer mit Blick auf die Vorgänge um den Runden Tisch in Köln-Chorweiler. „Aber wir waren in der Zusammenarbeit mit denen immer sehr zurückhaltend. Gerade in dieser Situation hätten wir ein klares Signal der Solidarität erwartet.“ Auf WELT-Anfrage verneinte die städtische Ditib, entsprechende Mails formuliert zu haben.
Die Kölner Ratsfraktionen reagierten unterschiedlich auf das Zerwürfnis in Chorweiler. Die SPD erklärte, sie bedauere den Bruch und unterstütze alle Bemühungen, zum interreligiösen Austausch zurückzukehren.
Die CDU wollte den Rückzug selbst nicht kommentieren, stellte aber den Besuch von Ministerpräsident Wüst und OB-Kandidat Greitemann in der Synagogen-Gemeinde heraus. Wüst habe dort gesagt: „Wer Hass sät, spaltet – wer sich erinnert, schützt unsere Demokratie.“ Greitemann betonte: „Jüdisches Leben in Deutschland, insbesondere in Köln, zu schützen, ist für uns oberste Pflicht. Jeder Mensch muss sich in unserem Land sicher fühlen dürfen. Als Oberbürgermeister werde ich für Sichtbarkeit und Sicherheit von jüdischem Leben eintreten.“
Deutlich schärfer äußerte sich die Kölner FDP. OB-Kandidat Volker Görzel sprach von einem „Alarmzeichen“ und forderte, dass alle Beteiligten sich eindeutig zu Demokratie und jüdischem Leben bekennen müssten. Besonders Ditib müsse sich „eindeutig von Ankara lösen“.
Auch aus der Landespolitik kam ein Signal. Nathanael Liminski, Chef der NRW-Staatskanzlei und enger Vertrauter Wüsts, sprach von „großer Sorge“ angesichts des eskalierten Streits. Der interreligiöse Dialog, für den der Runde Tisch stehe, sei „wichtiger denn je – gerade im Schatten des Gaza-Kriegs und der immensen Zunahme antisemitischer Vorfälle“. Die Initiative aus Chorweiler sei lange ein „leuchtendes Beispiel“ gewesen. Nun gehe es darum, „mit allen Seiten zu sprechen und im wahrsten Sinne des Wortes an den gemeinsamen Tisch zurückzuführen“.
Ob die Synagogen-Gemeinde an den Runden Tisch zurückkehrt, lässt Abraham Lehrer offen: „Wir sind ein Volk der Propheten, aber in die Zukunft sehen können wir nicht. Gesprächen verweigern wir uns nicht, aber erwarten tue ich persönlich nichts mehr.“
Maximilian Heimerzheim ist Volontär im Innenpolitik-Ressort.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke