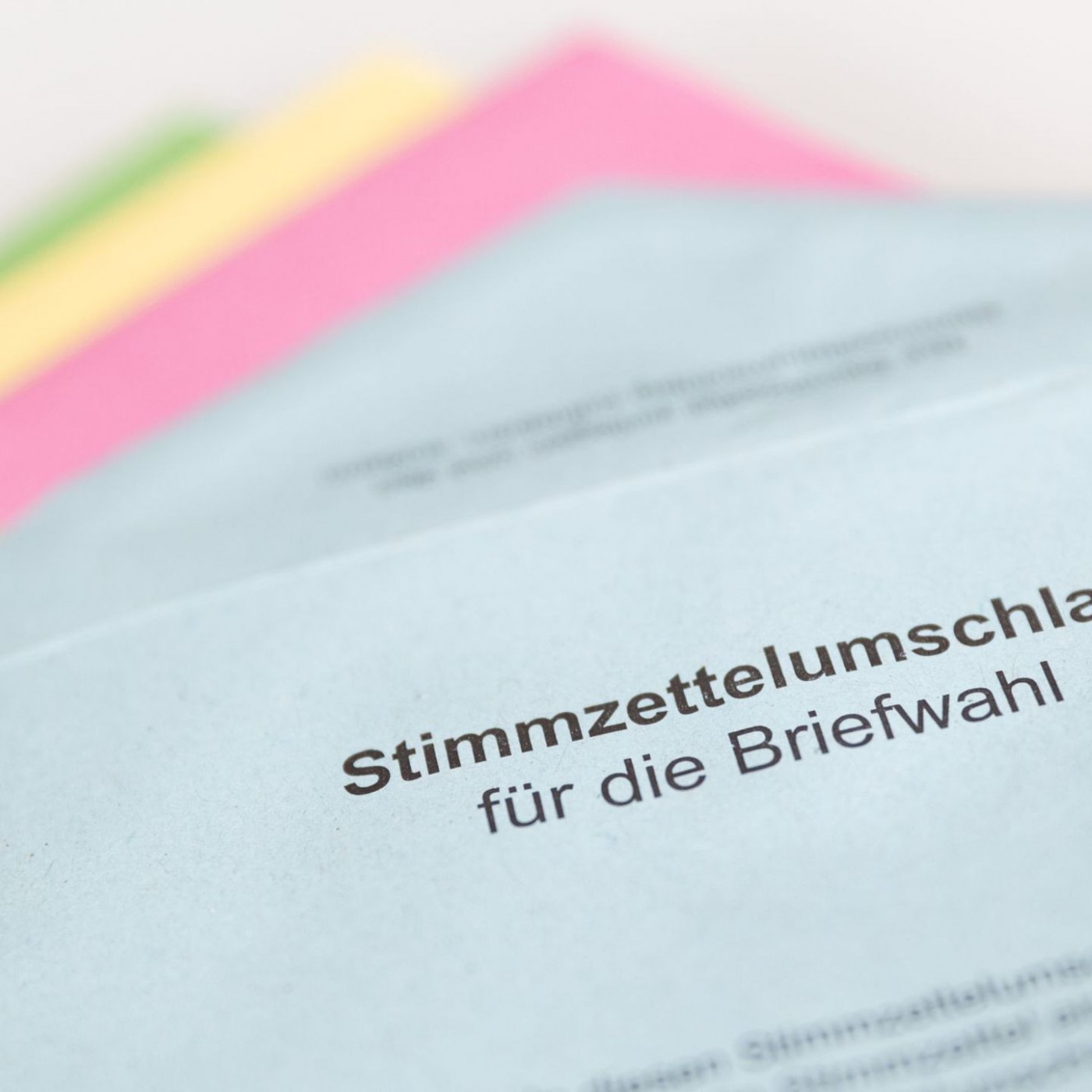„Konsequenzen ziehen“ – Macrons Kalkulation hinter dem hochrangigen Ukraine-Gipfel
Wenn der französische Präsident Emmanuel Macron an diesem Donnerstag zum Ukraine-Gipfel nach Paris einlädt, dann soll das die Position Europas und Kiew in den laufenden Verhandlungen stärken – aber auch ein Gegengewicht bilden zum Auflauf der Autokraten in China. Ein Thema steht in Paris im Vordergrund: mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. „Trump und sein Team müssen zuerst eine Einigung in Sachen Sicherheitsgarantien zwischen der Ukraine, anderen europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten erzielen“, schreibt Michael McFaul, ehemaliger US-Botschafter in Moskau, in einem aktuellen Artikel im Magazin „Foreign Affairs“. Doch welche Rolle Donald Trumps Amerika dabei zu spielen bereit ist, ist weiter unklar.
Die Franzosen betonen, dass das Treffen, zu dem Macron und der britische Premierminister Keir Starmer eingeladen haben, auf ausdrücklichen Wunsch Kiews stattfindet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bereits am Mittwochabend in Paris eingetroffen, um die Konferenz vorzubereiten. Bundeskanzler Friedrich Merz wird sich per Videolink zuschalten.
Auch der Zeitpunkt des Treffens sei bewusst gewählt, da die von US-Präsident Trump gesetzte Frist abgelaufen ist, innerhalb derer Moskau einer Friedenskonferenz mit ukrainischer Beteiligung zustimmen sollte. „Wir müssen Konsequenzen aus der Tatsache ziehen, dass sich Russland diesem Prozess verweigert“, so ein Berater des französischen Präsidenten im Vorfeld des Treffens.
Paris will mit der Konferenz signalisieren, dass die „Koalition der Willigen“ handlungsfähig ist. „Die Generalstäbe und Verteidigungsminister haben die technischen Vorbereitungen abgeschlossen. Wir sind nun in der Lage, Sicherheitsgarantien zu geben“, heißt es aus dem Élysée-Palast. Im Anschluss des Treffens wollen die Europäer mit Trump telefonieren und ihn über ihre Absprachen unterrichten.
Frankreich und Großbritannien wollen laut eines hochrangigen Diplomaten eine führende Rolle einnehmen, verweisen aber auch auf das „beträchtliche Engagement“ Polens, der baltischen Staaten und Dänemarks. Als Erfolg wird gewertet, dass die Koalition inzwischen auf über 30 Länder angewachsen ist, darunter auch nicht europäische Staaten. „Wir können auf die finanzielle Unterstützung von Kanada, Japan und Australien setzen“, so der französische Vertreter weiter.
Die Sicherheitsgarantien werden in drei Stufen unterteilt: An erster Stelle steht die langfristige Unterstützung der ukrainischen Armee. Das entspricht auch den sich verändernden Prioritäten in Kiew. Zwar arbeitet die ukrainische Regierung weiterhin daran, die westlichen Partner davon zu überzeugen, Truppen zu schicken, die einen Waffenstillstand absichern und neue russische Angriffe verhindern sollen.
Aber in der Ukraine hat man inzwischen erkannt, dass die verlässlichste Abschreckung gegen Russland darin besteht, die ukrainischen militärischen Fähigkeiten zu stärken - sei es mit westlichen Waffen oder mit finanziellen Hilfen, um die ukrainische Waffenindustrie weiter auszubauen.
Bodentruppen – aber weit entfernt von der Front
An zweiter Stelle steht dann für Paris die Entsendung von Bodentruppen, „mehrere tausend Soldaten, weit entfernt von der Front“, wie Macron formuliert, um Russland langfristig abzuschrecken. Dass sich Deutschland daran nicht beteiligen könnte, scheint man zu erwägen. „Jedes Land der Koalition hat eine Rolle zu spielen, sei es durch die Entsendung von Truppen in die Ukraine oder durch die Unterstützung derjenigen, die Truppen entsenden“, heißt es aus dem Élysée.
Die dritte Stufe betrifft den sogenannten „Backstop“, das US-amerikanische Sicherheitsnetz. Noch ist unklar, was dies genau bedeutet: Ist Trump lediglich zu logistischer Unterstützung bereit, oder wird es möglich sein, ihm das Versprechen abzuringen, die europäischen Streitkräfte zu unterstützen, falls sich Russland nicht abschrecken lässt? Bis kurz vor der Konferenz war auch nicht klar, wer Washington vertreten wird.
Trump hat die Lust am Thema Ukraine verloren
Im Weißen Haus spielt das Thema Ukraine derzeit eher eine untergeordnete Rolle. Trump beantwortete am Dienstag im Oval Office eine Frage zu Russland nur knapp. „Ich habe ein paar Dinge erfahren, die sehr interessant sind.“ Die Öffentlichkeit werde darüber „in den nächsten Tagen“ mehr hören. Er verfolge sehr intensiv, was der russische und der ukrainische Präsident bezüglich eines Treffens unternähmen, fügte Trump noch hinzu.
Russische Offizielle hingegen dementieren solche Äußerungen aus Washington stets und behaupten, es gäbe keine Pläne für ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Wladimir Putin, auch nicht in einem Dreierformat zusammen mit Trump.
Seit den Gipfeln von Alaska und Washington laufen zwischen den Europäern und der US-Seite jedoch intensive Gespräche über Sicherheitsgarantien für Kiew. Der US-Präsident hat mehrfach angedeutet, dass die USA eine Rolle übernehmen könnten. In Bezug auf die Sicherheit der Ukraine seien die Europäer bereit, „Soldaten zu stationieren. Wir sind bereit, ihnen da mit Sachen zu helfen, besonders, wahrscheinlich, in der Luft.“
Erleichterung bei den Europäern
Trumps Erwähnung von Luftabwehr löste bei den Europäern Erleichterung aus, denn der Kontinent ist weiterhin stark von den Luftabwehrfähigkeiten der Amerikaner abhängig. Doch der Republikaner macht bislang keine Anstalten, diese Ansagen mit Substanz zu untermauern. Hingegen hat er kategorisch ausgeschlossen, dass US-Truppen in der Ukraine stationiert werden könnten.
Auch bei Treffen zwischen Pentagon-Vertretern und europäischen Militärs wurde seit dem Gipfel in Washington am 18. August deutlich, dass sich die amerikanische Seite nicht stärker engagieren will. „Die US-Seite hat überhaupt nichts zugesagt“, zitierte „Politico“ einen Nato-Vertreter nach einem der Treffen.
Wie groß der Widerstand im US-Verteidigungsministerium gegen eine Beteiligung an den Sicherheitsgarantien ist, machte das Pentagon schon mehrfach deutlich. Unter anderem stoppte es in der Vergangenheit Waffenlieferungen an die Ukraine, teilweise sogar ohne Trumps Wissen.
Paris hingegen versteht die Ukraine-Konferenz auch als Antwort auf die Machtdemonstration der Autokraten in Peking in dieser Woche. Während der russische Präsident Wladimir Putin gemeinsam mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un an der chinesischen Militärparade teilnimmt, will Europa als Gegenpol wahrgenommen werden.
„Wir zeigen heute, dass wir das Friedenslager sind“, heißt es aus dem Élysée-Palast. Macron hatte Ende vergangener Woche erklärt, er sei „im Innersten“ davon überzeugt, dass Putin keinen Frieden wolle. „Er will die Kapitulation der Ukraine, das ist es, was er vorgeschlagen hat“, sagte der französische Präsident zum Abschluss des deutsch-französischen Ministerrats im südfranzösischen Toulon.
Sommeroffensive der Russen hat sich erschöpft
Inzwischen wird aber immer deutlicher, dass die Ukraine keineswegs unter Zeitdruck steht. Moskau hatte in den vergangenen Monaten erheblichen Druck an der Front in der Ostukraine ausgeübt, um den Eindruck einer immer näher rückenden ukrainischen Niederlage zu erwecken – was etwa in Washington zeitweise auch so wahrgenommen wurde. Tatsächlich jedoch scheint sich die Sommeroffensive der Russen weitgehend erschöpft zu haben, sehr langsame Fortschritte muss Russland weiter mit enorm hohen Verlusten bezahlen.
Und die russische Wirtschaft gerät zunehmend unter Druck. „Russland spürt die wirtschaftlichen Auswirkungen sekundärer Sanktionen gegen Importeure von russischem Öl und Gas und von den jüngsten ukrainischen Angriffen auf russische Ölraffinerien“, schreibt das Institute for the Study of War in seinem jüngsten Bericht über den Krieg.
Tatsächlich hat die Ukraine ihre auf Trumps Wunsch zeitweise ausgesetzten Angriffe auf russische Ölanlagen wiederaufgenommen, mit erheblichen Folgen für die russische Wirtschaft und Kriegswirtschaft. So werden aus mehreren russischen Oblasten und auch aus dem russisch besetzten Luhansk inzwischen erhebliche Engpässe bei der Treibstoffversorgung gemeldet. Und auch die verschärften Sanktionen gegen Russlands Ölindustrie hat zur Folge, dass Russland inzwischen erhebliche Preisnachlässe gewähren muss, um seine Rohstoffe loszuwerden, was die russische Staatskasse noch mehr unter Druck setzt.
Stefanie Bolzen berichtet für WELT seit 2023 als US-Korrespondentin aus Washington, D.C. Zuvor war sie Korrespondentin in London und Brüssel.
Martina Meister berichtet im Auftrag von WELT seit 2015 als freie Korrespondentin in Paris über die französische Politik.
Clemens Wergin ist seit 2020 Chefkorrespondent Außenpolitik der WELT. Er berichtet vorwiegend über den Ukraine-Krieg, den Nahen Osten und die USA.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke