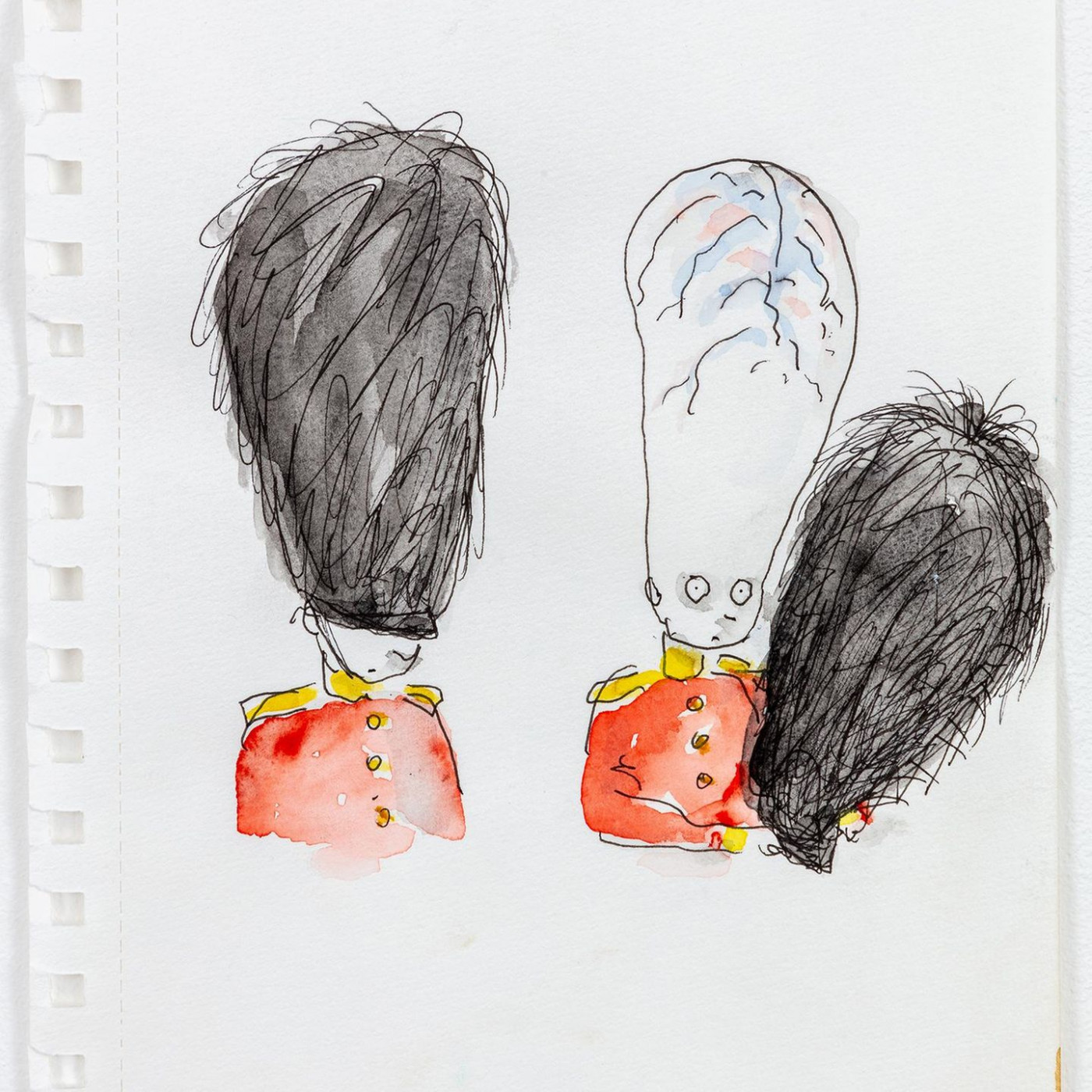Überfällig oder „sinnbefreit“? Streit über Fangverbot für Hering und Dorsch spitzt sich zu
Letzter Weckruf oder überzogener Alarmismus? Mit einem Plädoyer für den umgehenden und vollständigen Stopp der Dorsch- und Heringsfischerei an der deutschen Ostseeküste haben zwei Forscher des renommierten Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel den seit Jahren schwelenden Streit über die Zukunft der Ostsee-Fischerei neu angeheizt.
„Der Bestand ist mittlerweile so klein, dass er sich ohne ein generelles Fangverbot nicht erholen kann“, so der Meeresbiologe Rainer Froese zu WELT. Die Entscheidung des damaligen Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne), auf ein solches Fangverbot in der westlichen Ostsee zu verzichten, sei ein „Fehler“ gewesen.
Froese hatte seine Sicht der Dinge in der vergangenen Woche zusammen mit seinem Geomar-Kollegen Thorsten Reusch vor dem Umweltausschuss des Landtags von Schleswig-Holstein dargelegt. Demnach haben die ohnehin schon erheblichen Fangbeschränkungen für die beiden Fischarten in der Vergangenheit nicht für die dringend notwendige Erholung des Bestands in der westlichen Ostsee gesorgt.
So sei der Dorsch trotz des für ihn bereits seit Januar 2024 geltenden prinzipiellen Fangverbots „an der Grenze zur lokalen Ausrottung“ angelangt. Trotzdem dürfte dieser Fisch weiterhin „als Beifang gefischt, verkauft und verzehrt werden“. Froese und Reusch plädierten dafür, dass künftig jeder gefangene Dorsch „so schnell und schonend wie möglich“ wieder zurück ins Meer gesetzt werden müsse. „Jegliche Vermarktung muss beendet werden.“
Auch für den ebenfalls stark überfischten Hering fordern die beiden Wissenschaftler zumindest vorübergehend ein vollständiges Fangverbot, das auch jene Ausnahmen aufheben würde, die der damalige Agrarminister Özdemir der für die Fangquoten in Europa zuständigen EU-Kommission abgerungen hatte. Wenn die Fänge der vergangenen drei bis vier Jahre im Wasser geblieben wären, hätte sich der Heringsbestand voraussichtlich bereits wieder erholt, so Froese und Reusch im Landtag. Diese „einfache Methode“ könne auch jetzt noch funktionieren – „die Fänge von Kleinfischern und Anglern komplett einstellen, bis sich der Bestand erholt hat.“
Nach einer solchen Erholungsphase könne man die Heringsfischerei dann auch wieder hochfahren, prognostizieren die beiden Geomar-Forscher. Bis es so weit sei, müssten die Berufsfischer Ausgleichszahlungen von der öffentlichen Hand bekommen.
Anderes Institut hält Forderung für „sinnbefreit“
Für den Deutschen Fischereiverband, die Interessenvertretung der Berufs- und Angelfischer, gehen die Forderungen der beiden Wissenschaftler „weit an der Realität vorbei“. Aus Verbandssicht ist der Fischereidruck auf die beiden Fischarten durch die bestehenden Beschränkungen und die immer weiter zurückgehende Zahl der Fischer bereits jetzt so gering, dass diese gar keinen Einfluss mehr auf die Bestandsentwicklung in der westlichen Ostsee hätten.
„Eine Schließung der Fischerei auf Hering und Dorsch in Schleswig-Holstein“, so Verbandssprecher Claus Ubl, „hätte nur den Effekt, dass die gesamte Ostsee-Fischerei in Schleswig-Holstein für immer weg wäre.“ Fischerei könne man nicht einfach „an- und abschalten“. Auch die nachgelagerten Strukturen wie Genossenschaften, Kühl- und Lagerhäuser sowie Werften und Netzmacher „würden wegbrechen und nicht wiederkommen.“
Unterstützt wird der Fischereiverband in dieser Einschätzung von einer anderen namhaften Forschungseinrichtung, dem Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Dessen Leiter Christopher Zimmermann hält die Forderung der beiden Geomar-Wissenschaftler für „sinnbefreit“. Er halte nichts von einem totalen Fangverbot für Heringe in der Ostsee, da 84 Prozent des Bestands dieser Fischart in der Nordsee gefangen würden und der Bestand sich aus seiner Sicht deshalb auch dann nicht erholen würde, wenn man die übrigen 16 Prozent des Fangs vermeide. Tatsächlich findet der Großteil zumindest der Heringsfischerei im Nordatlantik, insbesondere in norwegischen Gewässern statt.
Die Fangmengen in der Ostsee haben sich dagegen tatsächlich stark reduziert. So zählte das für Fischerei zuständige Landwirtschaftsministerium von Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr noch knapp sechs Tonnen Dorsch und 324 Tonnen Hering, die Fischer aus dem Bundesland aus der Ostsee zogen. Im Jahr 2020 waren es noch 532 Tonnen Dorsch und 980 Tonnen Hering, 2010 sogar 3570 beziehungsweise 3603 Tonnen.
Auch aus Sicht des CDU-geführten Ministeriums würde es für den Bestand nichts bringen, „in einer solchen Situation einen Nullfang in der westlichen Ostsee“ festzusetzen. Bedauerlich sei vielmehr, dass „Norwegen bislang nicht bereit ist, seine Fänge an Hering in der südlichen Nordsee zu reduzieren, um eine schnelle Erholung des Bestandes an westlichem Hering zu ermöglichen“, teilt das Ministerium auf WELT-Anfrage mit.
Das Für und Wider eines Fangverbots spiegelt sich auch in der Haltung der zuständigen Abgeordneten des Bundestags. Während die für das Thema zuständige Sprecherin und Tierschutzbeauftragte der Grünen-Fraktion, Zoe Mayer, „die Bestände von Dorsch und Hering in der Ostsee für derart stark bedroht“ erklärt, „dass ein generelles Fischereiverbot der einzige Ausweg“ sei, warnt die Unionsfraktion dringend vor einem solchen Schritt.
„Würde man sich für ein generelles Verbot, also auch das Beifang-Verbot, entscheiden, wäre die Küstenfischerei an der deutschen Ostsee im Prinzip tot“, so der Berichterstatter der AG Landwirtschaft, Ernährung, Heimat in der Unionsfraktion, Christoph Frauenpreiß (CDU). Die Ursachen für den schlechten Zustand der Dorsch- und Heringsbestände seien „mannigfaltig“ und könnten nur durch „gemeinschaftliches Handeln aller Ostsee-Anrainer“ effektiv bekämpft werden.
Gegen ein generelles Fangverbot für Dorsch und Hering spricht sich auch die AFD-Bundestagsfraktion aus. Ihr fischereipolitischer Sprecher, Dario Seifert, fordert „flexible Fangquoten, gezielte Schonzeiten und den Einsatz nachhaltiger Fangmethoden, um sowohl den Bestand als auch die Existenz der Fischer zu sichern“.
Und auch die Linkspartei hat Zweifel, ob ein generelles Fangverbot ein gangbarer Weg wäre, um zu einer Erholung der Dorsch- und Heringsbestände in der westlichen Ostsee zu kommen. Dies müsse „in einem gesamtgesellschaftlichen Diskussionsprozess ausgehandelt und von Unterstützungsleistungen seitens der Politik begleitet werden“, so Marcel Bauer, Mitglied im Bundestagsausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat.
Die SPD-Bundestagsfraktion fand in der zurückliegenden turbulenten Parlamentswoche keine Zeit dafür, sich mit dem Thema Fischbestände in der Ostsee zu befassen. Das für die Fischerei zuständige Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat verwies darauf, dass die gezielte Fischerei auf Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee auch in diesem Jahr grundsätzlich ausgeschlossen und die maximal zulässigen Beifangmenge für den Dorsch noch einmal reduziert worden sei. Auch beim Hering sei der fischereiliche Druck bereits so gering, dass sich der Bestand langsam erhole und von der noch zulässigen „kleinen Küstenfischerei“ – anders als von den Geomar-Wissenschaftlern prognostiziert – „keine negativen Auswirkungen für die Bestandserholung zu erwarten“ sei.
Ulrich Exner ist WELT-Korrespondent für die norddeutschen Bundesländer
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke