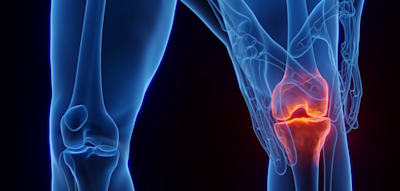„Der Druck, sich anzupassen und zu bestehen, ist brutal“
Junge Erwachsene sind heute im Schnitt deutlich unglücklicher als in den Jahrzehnten zuvor. Ein Team um den Glücksforscher David Blanchflower vom Dartmouth College in Hanover (USA) schreibt im Fachjournal „PLOS One“ von einer regelrechten Trendwende. Demnach habe sich die Unzufriedenheit eines Menschen im Verlauf eines Lebens als eine Art Hügel darstellen lassen: Sie nahm mit einigen Schwankungen bis zum mittleren Alter von etwa 50 Jahren – der sogenannten Rushhour des Lebens – zu und danach wieder deutlich ab. Das galt sowohl für Industrie- als auch für Entwicklungsländer, wie in verschiedenen Studien untersucht wurde.
Im Klartext: Den jungen und alten Menschen ging es im Schnitt gut, den mittelalten, die oft Karriere, Kindererziehung und womöglich Altenpflege gleichzeitig erbringen mussten, ging es schlechter – Sorgen, Depressionen und Stress kamen bei ihnen häufiger vor als in den jüngeren und älteren Altersgruppen. Diese Lebensunzufriedensheits-Kurve hat sich nun geändert: Junge Erwachsene sind am unzufriedensten, im Alter werden die Menschen glücklicher. Dieses Ergebnis bestätigt frühere Untersuchungen aus diesem Jahr.
Die Forscher analysierten für die ihre Studie umfangreiche Befragungsdaten von Erwachsenen in Großbritannien und den USA zu deren psychischer Gesundheit. Zudem wurden ähnliche Daten der sogenannten „Global Minds“-Studie von fast zwei Millionen Menschen aus 42 weiteren Ländern hinzugezogen, aus denen sich dem Team zufolge ableiten lässt, dass es sich bei der beschriebenen Veränderung um ein weltweites Phänomen handelt.
Die Studie zeige für die USA und Großbritannien, dass „psychische Probleme bei jungen Menschen am häufigsten auftreten und mit zunehmendem Alter abnehmen“, schreiben die Autoren. „Dies ist eine enorme Veränderung gegenüber der Vergangenheit, als psychische Probleme ihren Höhepunkt im mittleren Alter erreichten.“
Zufriedenheit steigt im Alter
Die gemittelten US-Daten für die Zeitspanne von 2009 bis 2018 ergeben noch den bekannten Hügel-Verlauf von Jung nach Alt, die Daten für die Zeitspanne von 2019 bis 2024 zeigen hingegen die neue Tendenz hin zur späteren Zufriedenheit. Das Unzufriedenheits-Niveau in der mittelalten Altersgruppe sank nicht übermäßig stark, sodass der veränderte Verlauf vor allem durch die enorme Verschlechterung des Zustands der Jüngeren zustande kam. Aber weshalb geht es den Jüngeren heute so viel schlechter als noch vor einigen Jahren?
„Die Gründe für diese Veränderung sind umstritten, aber wir sind besorgt, dass es heute eine ernsthafte Krise der psychischen Gesundheit unter jungen Menschen gibt, die angegangen werden muss“, schreiben Studienleiter David Blanchflower und seine Kollegen – und führen drei mögliche Gründe an: langfristige Nachwirkungen der Finanzkrise auf jüngere Generationen auf dem Arbeitsmarkt, Auswirkungen der Beschränkungen während der Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen der von Jüngeren viel genutzten sozialen Medien.
Der deutsche Makroökonom und Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel von der Technischen Hochschule Nürnberg hält die Ergebnisse der Studie für „sehr besorgniserregend“. Andere Studien hätten bereits ähnliche Tendenzen gezeigt. „Die Evidenz ist schlagend“, so Ruckriegel. Er sieht eine übermäßige Nutzung sozialer Medien – im Gegensatz zu den Folgen der Finanzkrise – als großen Einflussfaktor an. Jugendliche würden sich dort ständig vergleichen, mit anderen oder mit unrealistischen Idealen. „Wir wissen, dass diese Vergleiche hochproblematisch sind für unser Wohlbefinden.“
Kritik an der Methode der Studie
Ähnlich ordnet dies die Soziologin Hilke Brockmann von der Bremer Constructor Universität ein, die darin auch einen Grund dafür sieht, dass bei Mädchen und jungen Frauen die Unzufriedenheit besonders ausgeprägt ist. In den sozialen Medien würden Mädchen oft auf ihre Optik reduziert oder sexualisiert, sie würden auch viel häufiger Opfer im Internet.
Darüber hinaus provozierten die Netzwerke, dass sie sich nicht nur mit den anderen Mädchen aus der eigenen Clique, sondern mit weit mehr anderen Menschen verglichen, auch mit Figuren, die es so real gar nicht gebe, erklärt die Wissenschaftlerin. „Die ganze Welt wird zu meiner Peer Group. Der Druck, sich anzupassen und zu bestehen, ist brutal.“
Brockmann sieht jedoch auch einige Knackpunkte bei der Methodik der Studie: So sei die Datenauswertung nicht dazu geeignet, Aussagen darüber zu treffen, ob die beobachteten Zusammenhänge zur mentalen Gesundheit tatsächlich durch das Alter und nicht vielleicht durch andere unabhängige Faktoren – wie etwa die Verbreitung von Smartphones oder den Ukraine-Krieg – ausgelöst würden.
Denkbar sei auch, dass sich diese beobachteten Effekte nur auf eine Kohorte von Jugendlichen beschränken, etwa auf diejenigen, die in der Corona-Zeit in der Pubertät waren und besonders stark unter den Beschränkungen gelitten haben. „Deshalb weiß man jetzt nicht: Werden die Jüngeren auch in Zukunft eine labilere mentale Gesundheit haben oder ist das vielleicht nur ein vorübergehendes Phänomen? Letzteres wäre meine Vermutung – und Hoffnung“, so Brockmann. Längerfristige Veränderungen lassen sich jedoch aus den Daten nicht ablesen.
Sowohl Brockmann als auch Ruckriegel bestätigen den großen Einfluss der Corona-Pandemie und halten es zudem für wahrscheinlich, dass auch die düstere, unberechenbare Weltlage mit Kriegen und Klimakrise einen Einfluss hat. Bleibt die Frage: Ist die mögliche Trendwende eigentlich schlimm? Immerhin scheint die Zufriedenheit ja über die Lebensspanne hinweg zuzunehmen.
Das Forschungsteam weist jedoch auf die weitreichenden Auswirkungen psychischer Probleme hin – von damit verknüpften körperlichen Problemen bis hin zu Schulleistungen oder der Beteiligung am Arbeitsmarkt. Auch Brockmann betont: „Das Jugendalter ist ein besonders wichtiger Lebensabschnitt. Wenn man die jungen Menschen in diesem Alter an mentale Erkrankungen verliert, dann verliert man sie eventuell für das ganze Leben.“
Erst kürzlich hatte das Robert Koch-Institut (RKI) eine Analyse präsentiert, der zufolge der Anteil derjenigen, die ihr Wohlbefinden als gering einstuften, mit fast 40 Prozent bei den 18- bis 29-Jährigen besonders hoch ist. Bei den 65- bis 79-Jährigen lag der Wert nur bei etwa 17 Prozent.
Zudem zeigte eine im Journal „Nature Mental Health“ vorgestellte Analyse, dass der Wohlbefinden-Index im Mittel von 22 betrachteten Länder bis zum 50. Lebensjahr im Wesentlichen gleich blieb und erst mit dem Alter anstieg. Jüngere Jahrgänge hätten offenbar mehr Probleme als frühere Generationen, schreibt das Team dieser Studie.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke