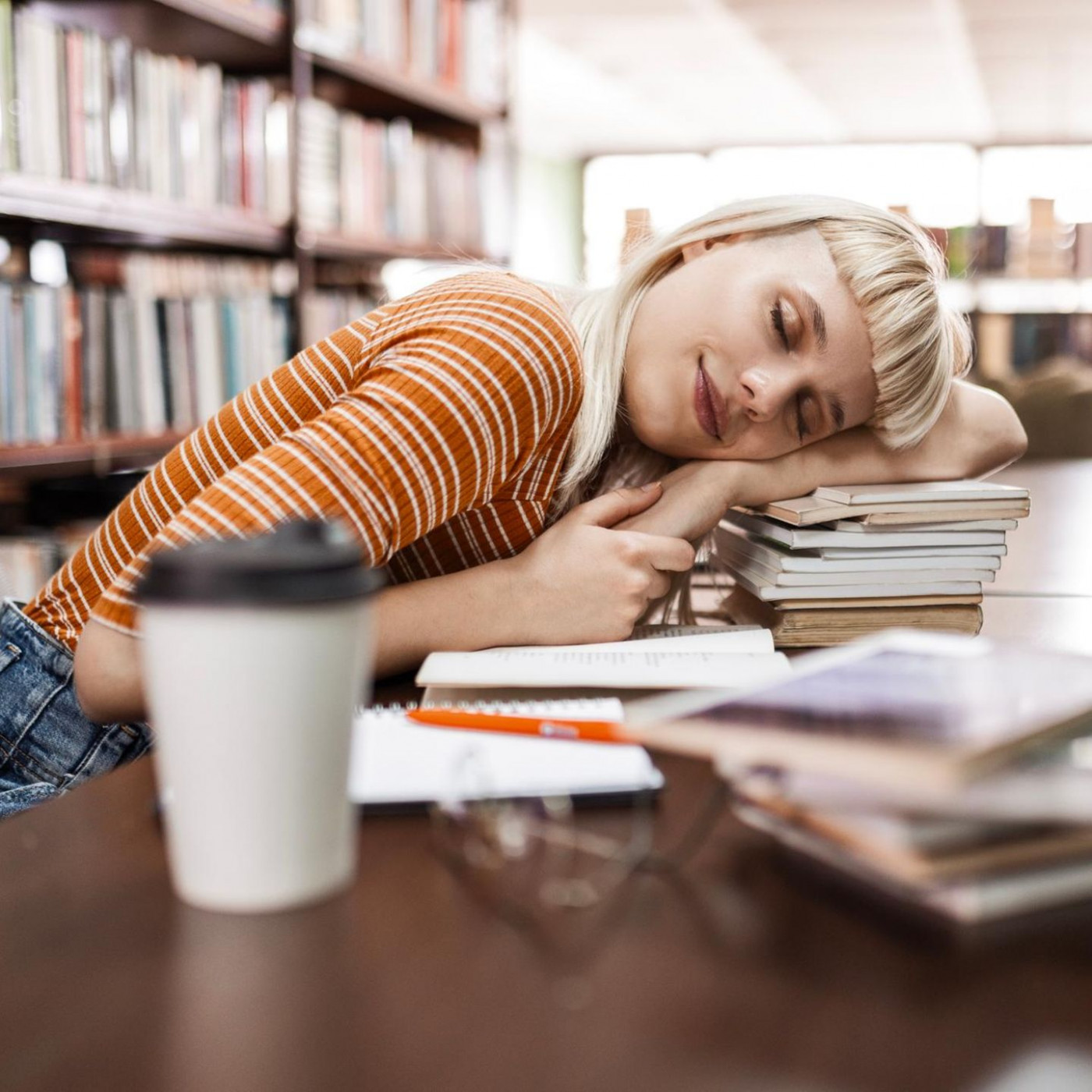Atomreaktor auf dem Mond – die wichtigsten Antworten zum ambitionierten Nasa-Plan
Im Jahr 2030 soll ein Atomreaktor auf der Mondoberfläche Energie produzieren. Was wie Science-Fiction klingt, soll laut Nasa Realität werden. Die US-Raumfahrtbehörde plant einem Bericht der US-Nachrichtenseite „Politico“ zufolge den Bau eines solchen Reaktors auf der Oberfläche des Erdtrabanten.
Die Pläne wurden offiziell bisher weder bestätigt noch dementiert. Doch wie wahrscheinlich wäre solch ein Vorhaben innerhalb von fünf Jahren?
Ist der Bau eines Atomkraftwerks bis 2030 realistisch?
„Ja“, sagt Markus Landgraf, der Weltraumprojektmanager der europäischen Raumfahrtbehörde Esa. Das sei ja nichts völlig Neues, und es habe schon reichlich Vorarbeiten und Technologieforschung gegeben. In der Nukleartechnik stecke viel Potenzial. „Das ist genau diese Situation, in der eigentlich der Bedarf lange existiert, aber aus politischen Gründen hat man diese Technologie bislang nicht umgesetzt“, erklärt der Esa-Experte. „Geforscht wurde fleißig, nicht nur in Amerika, auch in Europa.“
Wie kann man einen Reaktor auf dem Mond bauen?
Der Reaktor werde wahrscheinlich nicht auf dem Mond gebaut, sagt Landgraf. Er werde als Komplettteil dorthin geliefert, dort dann aktiviert und ferngesteuert. „Die größte technische Herausforderung ist die Kühlung. Es gibt ja kein Wasser, keine Luft, die man nehmen könnte. Man muss also Strahlungskühlung verwenden.“ Das Prinzip sei nicht neu: Man benutze ein Kühlmittel, das dann mit einer relativ hohen Temperatur direkt in den Weltraum abstrahle, schildert Landgraf das Prozedere.
Warum braucht man ein AKW auf dem Trabanten?
„Wenn man einen Atomreaktor hat, dann öffnet man für die astronautische Erkundung viel größere Gebiete auf dem Mond“, sagt Landgraf. Man sei dann nicht mehr darauf angewiesen, in den Polarregionen zu sein, wo man für die Energiegewinnung durch Solarpaneele unter Umständen etwas längere Zeiten mit Sonneneinstrahlung habe. Generell geht auf dem Mond nach 14 Tagen die Sonne unter – für die nächsten 14 Tage. Diese Zeit, so Landgraf, könne man nicht mit einer Batterie überbrücken.
„Man braucht es auch für die Gewinnung von Ressourcen auf dem Mond“, ergänzt Landgraf. Es gehe um die Fähigkeit, industriell zu operieren und Bodenschätze zu gewinnen. „Wir wollen Ressourcen im Weltraum gewinnen, uns die unendlichen Ressourcen, die eben der Weltraum bietet, erschließen.“ Das sei das eigentliche Rennen. „Und dafür brauchen wahrscheinlich die USA, wie alle anderen auch, ein AKW.“
Ist ein AKW auf dem Mond gefährlich?
„Wenn das AKW auf dem Mond im Betrieb ist, ist im Umkreis von 50 Metern die Strahlung für Menschen tödlich und auch für Roboter zu hoch“, sagt Landgraf. Ein Risiko für das Kraftwerk sei der mangelnde Schutz vor einschlagenden Himmelskörpern auf dem Mond, der keine Atmosphäre habe. Man müsse sich daher genau überlegen, wie stark man einen Meteoriten-Schutzschild baut.
Was planen andere Raumfahrtnationen?
Russland hat schon vor Jahren angekündigt, ein AKW auf dem Mond zu bauen. Das Land will dort nach Angaben seiner Raumfahrtbehörde Roskosmos gemeinsam mit China zunächst eine kleinere Anlage für Nuklearenergie aufstellen. Die Vorbereitungen dafür sind demnach bereits im Gange.
Getestet werden soll die Anlage zuerst auf der Erde, 2036 soll sie dann zum Mond gebracht werden. Danach soll dort der Bau eines Atomkraftwerks beginnen – am Mondkrater Peary. Zur Energiegewinnung sollen zunächst auch Solaranlagen genutzt werden.
„Ziel ist es, das erste Atomkraftwerk auf dem Mond zu bauen – als Fundament für künftige Mondbasen“, betonte Roskosmos-Chef Dmitri Bakanow noch im Juni. Sein Amtsvorgänger Juri Borissow hatte im vorigen Jahr einen Zeitrahmen von 2033 bis 2035 genannt.
Russland und China hatten 2021 eine Absichtserklärung unterzeichnet für eine Zusammenarbeit beim Bau einer Raumstation bis 2035. Seither verzögern sich Moskauer Projekte immer wieder – auch wegen des teuren und von westlichen Sanktionen begleiteten russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
Allerdings sollten gemäß dem bisherigen Fahrplan schon bis zu diesem Jahr jeweils drei chinesische und drei russische Mondmissionen mit Raumsonden absolviert werden. Seit dem Absturz der russischen Sonde „Luna-25“ 2023, der ersten Mission seit fast 50 Jahren, gelten die Zeitpläne als unsicher.
Was sind Chinas Mondpläne?
Nach mehreren erfolgreichen Rover-Missionen zum Mond rückt für die aufstrebende Weltraummacht China ein neues Ziel in den Vordergrund. Angestrebt wird eine bemannte Mondlandung bis spätestens 2030. Dafür werden eine neue Generation von Trägerraketen, eine Landefähre sowie spezielle Ausrüstung entwickelt.
Zugleich treibt Peking den Aufbau einer „Internationalen Mondforschungsstation“ (ILRS) voran. Die Anlage soll langfristig robotergestützt betrieben und bei Bedarf zeitweise von Menschen genutzt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. 17 Staaten und internationale Organisationen sowie über 50 Forschungseinrichtungen hatten demnach bis April mit China Kooperationsabkommen abgeschlossen.
Die ILRS ist als wissenschaftliche Versuchsanlage konzipiert, mit Modulen auf der Mondoberfläche und im Mondorbit. Sie soll in zwei Phasen entstehen: Bis 2035 ist eine erste Basisstation am Südpol des Mondes geplant. In den 2040er-Jahren soll eine erweiterte Version folgen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke